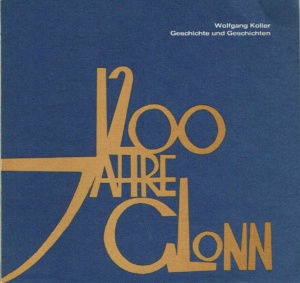Teilstrecke: 10,3 km
Anfahrt:
Nach Glonn: Buslinien 413, 440 und 463
Nach Unterelkofen: Buslinie 447, 9495, 2447, Bahnlinie DB 50
Nach Grafing-Stadt: S-Bahnlinie S5, Buslinien 440, 442, 444, 445, 447, 2447, 9421, 9441 und 9495
Nach dem Besuch der Pfarrkirche in Glonn, die dem HI. Johannes geweiht ist und in den Jahren 1993/94 im Innenraum vollständig renoviert worden ist, gehen wir in östlicher Richtung die Professor-Lebsche-Straße ca. 250 m. überqueren dabei die in Nord-Süd-Richtung fließende Glonn (an der Brücke ein altes Mühlrad = Glonner Marktwappen) und halten uns dann links. Richtung Grafing und Ebersberg (Zinneberger Straße = EBE 13). Nach ca. 250 m gehen wir an der Wolfgang-Koller-Straße (Staatsstraße 2351 ( sie führt nach Moosach) vorbei und folgen weiterhin auf der linken Straßenseite der Zinneberger Straße bergauf bis zur Ortstafel (ca. 1 km). Gleich nach der Ortstafel sehen wir ein kleines Kommunalgebäude (Wasserwerk) auf unserer Straßenseite, dahinter befindet sich der Eingang in den Park des Schlosses Zinneberg. Sollte das Eingangstor verschlossen sein, so gehen wir die Zinneberger Straße geradeaus bis zur nächsten Straßenkreuzung. wo wir der Straße nach links (Norden) folgen bis wir wieder auf unsere Markierung stoßen.
Ist das Eingangstor zum Naturschloßpark am Steilufer der Glonn geöffnet. so gehen wir bergauf bis wir den Hof des Schlosses erreichen (250 m). Dort gehen wir an der nördlichen Gebäudeseite entlang (Schule mit Internatsbetrieb), halten uns stets links und erreichen nach dem letzten Gebäudeteil einen nach Norden führenden Weg (links Wald, rechts Viehweide). Diesen Punkt erreichen wir aber auch. wenn wir uns vom Schloßhof aus stets rechts halten, wir stoßen auf eine querende Straße (wir sehen dabei vor uns einen Weiher) und folgen ihr nach links, um nach 300 m ebenfalls an den besagten Punkt zu gelangen. Jetzt folgen wir der Sandstraße ca. 300 m bis zu einer Straßengabel im Wald. Hier folgen wir dem Weg nach rechts (Ost) bis wir nacheiner andreaskreuzförmigen Wegkreuzung auf eine querende nordsüdverlaufende andstraße stoßen, der wir nach links (Nord) folgen.
Nach einem einige hundert Meter langen Linkskurvenzug umfangen uns Wiesenflächen mit verschiedenen modernen Kunstwerken. Dort erblicken wir nach ca. 500 m das Gut Sonnenhausen. das zum Öko-Gut Hermannsdorf gehört. Am Gutshofeingang angelangt, können wir den Jugendstil des ehemaligen Besitzes des Grafen Büssing bewundern. Graf Büssing wollte vor der Jahrhundertwende im Königreich Bayern Kronrat werden, schaffte es aber trotz seinem vielen Reichtum nicht. Nach seiner Niederlage verkaufte er seine Güter Sonnenhausen, Georgenberg, Hermannsdorf und Niederseeon sowie sein Schloß Zinneberg und quartierte sich als Junggeselle bis zu seinem Tod in ein Gastzimmer des Gasthofes zur Post in Glonn ein. Wir setzen unseren Weg fort (200 m) und bewundern am benachbarten Schweigerhof die Rinder im Freilaufstall (noch oder bis vor kurzem). Nach dem Hof gehen wir den Weg geradeaus und gelangen nach 200 m an eine Weggabel.
Wir folgen dem schmäleren Weg in Richtung Nordosten bis zum Waldeck. Dort betreten wir den Hochwald und folgen dem etwas verwachsenen Waldweg bis wir nach ca. 200 m wieder auf eine Forststraße stoßen, der wir dann einen Kilometer bis zur Kreisstraße EBE 13(Grafing – Glonn) folgen. Am Wegzwickel halten wir uns nach links und gehen an der relativ verkehrs- reichen Asphaltstraße 200 m Richtung Grafing (links, Norden), um dann wieder einer Sandstraße durch Wiesen nach rechts in den Wald zu folgen. Nach 250 m stoßen wir auf die querende Straße nach Wildenholzen (800 m, Einkehrmöglichkeit Cafe‘ Bauer). Wir gehen nach rechts, Richtung Süden, nach 250 m folgen wir der Straße zum Weiler Eichtling nach links (Ost).
Nach 600 m biegt ein Weg nach rechts ab, das Gelände ist hier mit Stangenzaun und Hecken umfaßt, der zum Ökogut Herrmannsdorf führt, wo Einkehr- und Einkaufsmöglichkeit besteht. Wir setzen unseren Weg fort und erreichen nach 300 m den Weiler Eichtling. Wir gehen durch den Weiler Eichtling, der längst keine reine Bauernhofsiedlung mehr ist, sondern mehr zu Wohnhäusern und Reiterhof umfunktionierte Höfe hat. Danach führt uns der aussichtsreiche Weg steilbergab in einer nach Norden ausholenden weiten Serpentine in das trogförmige Moosachtal hinab. Auf der Anhöhe des nordseitigen Moosachtal- hochufers thront die St.-Michael-Kirche von Alxing. Am Fuß des Hanges, en wir herabstiegen, liegt rechts von uns ein Sommerstall für Rinder. Vor uns eine kultivierte Moorlandschaft, das Brucker Moos. Es ist seit 1924 weitgehend rockengelegt.
Jetzt befinden wir uns in einem Schutzgebiet für Wiesenbrüter. Der Weg darf hier laut Gesetz nicht verlassen werden. Hier können gelegentlich uch Störche, Reiher und andere seltene Vogelarten beobachtet werden. 400 m nach dem Stall queren wir auf einer kleinen Brücke die Moosach, um dann 200 m weiter, vorbei an Bäumen und Gebüsch, über eine weitere Brücke einen zweiten Bachlauf der Moosach zu queren. Links auf dem Moosachtalboden sehen wir Bruck mit seiner Peter-und-Paul- Kirche. In Bruck befindet sich das Gasthaus Bruck, doch es verlangt einigen Aufwand, um dorthin zu gelangen. Immer wieder gliedert ein kleines Wäldchen oder Gebüsch die nassen und trockenen Moorwiesen auf. Schilfrohr an kleinen Entwässerungs- gräben macht die Landschaft malerisch. Hinter uns im Südwesten ragt das Hochufer auf und der Giebel eines Bauernhauses von Eichtling grüßt herunter, vor uns lockt Alxing zur Einkehr ins Wirtshaus (Holzverbund 1850/60 am Hofgebäude).
Einen knappen Kilometer nach der Moosachbrücke treffen drei Wege zusammen und unser Weg führt jetzt bergauf, an inem stattlichen einzelnstehenden Bauernhof vorbei, auf die Teerstraße (200 m), die von der Kreisstraße EBE 13 in das Dorf Alxing hinaufführt (300 m). Hier treffen wir auf den Gasthof Alxinger Wirt und eine Bäckerei. Unser erster Besuch gilt der St.-Michael- Kirche mit ihrer landschaftlich reizvollen Lage als Aussichtskanzel. Bei klarem Wetter bietet dieser Platz eine unvergleichliche Aussicht im Bogen von Nordwest über West nach Südost. Das Moosachtal, Bruck, hinein ins Glonn- und Mangfalltal, bis hin zum Mangfallgebirge. Auf dem Dorfplatz treffen wir auf das neue Verwaltungsgebäude der Gemeinde Bruck und die Haltestelle der Buslinie 440 (Grafing-Bhf./S5 und DB 50 – Bruck – Moosach – Glonn und zurück). Nach Einkehr und Versorgung können wir unseren Weg fortsetzen und gehen südostwärts durch die Ortschaft, bis wir auf die Straße Pienzenau – Obereichhofen stoßen (100 m), der wir nach rechts (Südost) ca. 100 m folgen, bis ein Feldweg nach links, genau nach Osten, abzweigt.
Ihm folgen wir durch weithügeliges Acker- und Wiesenland, bis wir nach 800 m wieder auf Wald treffen. Unterwegs sichten wir ein sonderbares abstraktes Kunstgebilde unbekannter Herkunft. Links vorn Weg (nördlich) sehen wir eine 220-kV-Hoch- spannungsleitung, die vorn Münchner Norden bis nach Marienberg bei Rosenheim und weiter führt. Nach 300 m Wald treten wir wieder auf Wiesenland und sehen unter uns die Einöde Loch, die hier in einem kleinen Bachtal an einer Wasserscheide zwischen Moosach und Attel liegt. Das Bacherl fließt der Attel und nicht der nähergelegenen Moosach zu. Wir Stoßen hier auf die Straße Obereichhofen – Hittlkofen, die wir queren, um gleich wieder entlang einem Stück Waldrand mit Buchen in den Wald zutreten. Unser Weg führt jetzt Richtung Südost durch das Gehölz (400 m), bis er auf einen querenden Waldweg stößt, dem wir nach links (Ost) folgen.
Nach 200 m treten wir wieder aus dem Wald und befinden uns im Atteltal. Nach ca. 300 m Wiesen und Felder treffen wir auf eine Sandstraße (Obereichhofen – Oberelkofen), auch die Hochspannungsleitung quert hier die Sandstraße. Wir gehen jetzt in Richtung Norden nach Oberelkofen, das wir am südlichen Dorfeingang auf der Staatsstraße 2089 (Oberelkofen – Lorenzenberg) betreten. Hier finden wir einen Bahnhaltepunkt der Bahnstrecke DB 50 München – Rosenheim und Haltestellen der Buslinien 9495 (Grafing-Bhf./S5/DB 50 – Lorenzenberg – Aßling – Oberelkofen – Rosenheim/DB 50 und zurück) und 447 (Lorenzenberg – Oberelkofen – Grafing-Bhf./S5 und zurück vor. Der Gasthof Hupfer (Eintragungsstelle, siehe Kap. 8) lädt uns zu Rast und Brotzeit ein. Wir schauen uns die hübschgelegene Barockkirche an und besuchen die Gedenkstätte eines dramatischen Unglücks. Im Juni 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, blieb ein Transportzug mit heimkehrenden Wehrmachts- angehörigen wegen eines Schadens an der Lokomotive liegen. Ein nachfolgender schwerer Güterzug mit amerikanischen Panzern prallte mit voller Wucht auf den stehenden Zug. 104 deutsche Soldaten und ein Amerikaner fanden den Tod.
Sie sind hier auf einem kleinen Soldatenfriedhof begraben. Nach dem Besuch der Gedenkstätte wechseln wir auf der Teerstraße nach Unterelkofen auf die andere Seite der Bahnlinie DB 50 (München – Rosenheim) und erreichen auf dieser nach ca. 700 m in Richtung Nordost die Schloßanlage von Unterelkofen, die sich seit Generationen im Besitz der Grafen von Rechberg befindet. Wenn wir nun nach links (Nordost in die Dorfstraße von Unterelkofen einbiegen, sie führt auch in die Stadt Grafing (Schloßstraße), kommen wir nach 100 m zur Schloßgaststätte (Eintragungsstelle, siehe Kap.8). Nach der Einkehr können wir das Schloß Elkofen besichtigen, aber leider nur von außen, da es bewohnt ist. Vor dieser Höhenburganlage sollen hier bereits im 10. Jh. Festungs- bauten bestanden haben. Der Kern der Burg wurde 1383 ausgebaut und war bis 1506 im Besitz der bayerischen Herzöge. Die obere Burg ist spätgotisch und besteht aus Bergfried, Pallas, Kemenate (früher der einzige heizbare Raum, der vorzugs- weise von den Frauen bewohnt wurde), Dürrnitzstock und Wehrgang. Die Vorburg entstand in der Zeit des 14. und 16. Jh.s Die St.-Georg-Kapelle wurde 1516 erbaut und 1719 barockisiert. Die Nebengebäude stammen hauptsächlich aus dem 17. Jh. – Im Jahr 1664 wurde ein weiterer Ausbau der Burg durchgeführt. Die Grafen von Rechberg erwarben die Burg vom bayerischen Herzog und bauten sie zu einem Jagdschloß um. Um 1800 wurde der Wassergraben der Burg in eine Parkanlage verwandelt.
Als der Zweig des Grafengeschlechts ausstarb, verfiel die Burg. 1871 erwarb ein anderer Zweig der Grafen von Rechberg die Burganlage und ließ sie 1899 von Gabriel von Seidl neu gestalten. Nach der interessanten Besichtigung suchen wir uns ein Quartier in der näheren Umgebung, wobei wir sicher in der Stadt Grafing fündig werden. Grafing liegt nördlich zweier bewaldeter Oser-Hügel aus der letzten Kaltzeit, dem Großen und dem Kleinen Dobel. Auf der Straße, die uns bereits zur Schloßgaststätte führte, können wir nach etwa 1,5 km den Marktplatz von Grafing-Stadt erreichen (Allee, dann Schloßstraße, Rosenheimer Straße links (Nord)). In dessen Nähe sich der S-Bahnhof der Linie S5 (Herrsching – München – Ebersberg) und die Haltestellen der Bus- linien 444 (Schalldorf – Aßling – Grafing-Stadt/S5 – Grafing-Bahnhof/S5/DB 50 und zurück) und 445 (Grafing-Stadt/S5 – Grafing- Bahnhof/S5/DB 50 – Ebersberg/S5 – Erding/S6 und zurück) befinden. Grafing ist eine sehenswerte Kleinstadt mit Stützpunkten aller Art.