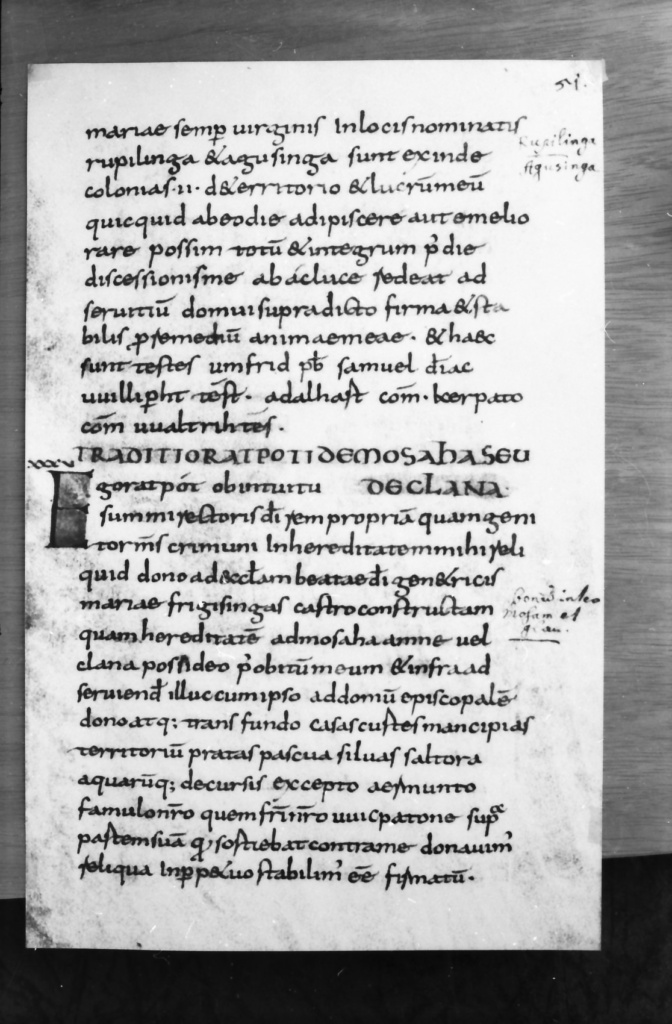Wolfgang Koller: Zwölfhundert Jahre Glonn
Geschichte und Geschichten
Bilder und Bildauswahl von Läszlö Schwarzenberger
Als Festschrift zum Jubiläum 1974 herausgegeben von der Marktgemeinde Glonn
Alle Rechte bei den Verfassern Wolfgang Koller und Lászlò Schwarzenberger, Glonn Grafische Umschlaggestaltung Magda Gürteier, München-Glonn Gesamtherstellung Allgäuer-Druck, 8261 Marktl/tnn, Telefon 08678/394
Das Jahr 774
Es war ein Jahr wie jedes andere Jahr: ein kleiner Tropfen Zeit im unendlichen Rauschen der Ewigkeit, eine Stunde zwischen dem unbegrenzten Gestern und einem nicht abzuschätzenden Morgen, ein irdischer Tag unter Sonne und Wolken und eine Nacht „unter der unermeßlichen Kälte des blinkenden Sternenhimmels“, ein Vorbeiflug auf der langen Strecke zwischen dem Weltenanfang, dem unerforschten, und dem Weltuntergang, dem unbekannten. Was sollte uns da jenes ferne Jahr noch bewegen, uns. die wir 1200 Jahre darnach in Freud und Leid, sorgend und besorgt, uns wehrend und manchmal nicht bewährend die Kreise unseres Daseins zu vollenden haben?
Aber 774 hatte ein Mann gelebt, der hatte einen Baum gepflanzt, der bis heute nicht zerbrochen ist, den Baum der Glonner Geschichte. Es war Ratpot, der Sohn des Criminus; er schenkte am 21. März jenes frühen Jahres seinen Besitz an den Flüßchen „Mosaha amne“ und „Clana” der Marienkirche auf dem heiligen Berg in Freising; er beurkundete, daß er es „auf Eingebung des höchsten göttlichen Lenkers“ tue. So ist denn in den Grundstein der Geschichte Glonns der Name des dreifältigen Gottes eingeschrieben.
Wenn auch noch andere fließende Gewässer in Oberbayern den gleichen Namen „Glonn“ tragen, so ist doch nicht daran zu zweifeln, daß Ratpot lebte, wo wir leben, kennzeichnet er doch seinen wohl weitausgedehnten Herrenbesitz mit „Ländereien, Weiden, schluchtreichen Wäldern und herabstürzenden Wassern“.
Und das alles trifft genau auf unsere Landschaft zu; da sind die Schluchten in Sonnenhausen und Haslach, die Wiesen auf den Hügeln, die Weiden in den drei Tälern und die herabstürzenden Wasser in der Naturgrotte von Ursprung. Und Stifterdemut und Besitzerstolz haben in der Urkunde von 774 den ersten Lobpreis auf die Schönheit unserer heimatlichen Landschaft gesungen.*)
Welch wundersame Wirkung einer guten Tat: Ratpots Name hat ein Jahrtausend überlebt. 774 lebte in der Burg des Baiernherzogs, mit dem Blick auf die Marien- und Bischofskirche, der kluge, tätige und schreibgewandte Bischof Arbeo. „Mit großer Freude“ hatte Papst Gregor III. nach dem Plane von Bonifatius Salzburg, Passau, Regensburg und Freising zu Bischofssitzen des Baierlands erwählt. Arbeo hatte Korbinians Leiche von Südtirol nach Freising überführen lassen. In Arbeos Lebensgeschichte des hl. Emmeram berauscht sich sein dichterisches Wort an der Schönheit des Landes zwischen Freising und den Bergen: „Es ist sehr gut und lieblich anzusehen, reich an Hainen, wohlversehen mit Wein. Es besitzt Eisen in Fülle und Gold, Silber und Purpur im Überfluß. Das Land ist von klaren Quellen und Bächen bewässert. Der Erdboden scheint von Vieh und Herden aller Art fast bedeckt zu sein. Seine Männer sind hochgewachsen und stark, auf Nächstenliebe und Sitte gegründet“. Vielleicht sind hier Ratpots Land und Person schon mitbeschrieben.
*) Berganger ist schon 764 nachweisbar. So hatten unsere Nachbarn im Osten recht, wenn sie beim heurigen Glonner Faschingszug anschrieben: „Berganger ist 10 Jahre älter wia Glo. / Feiern tean mia net. / Aber g’freun tuats uns do“.
S. 2
Die klaren Wasser der Glonn, wohl ein wenig mächtiger als heute, sind auch damals schon, entgegen der sonstigen Richtung der großen Flüsse des Hochlandes, nach Süden gelaufen, der Mangfall zu. Wo heute Rosenheim landhaft — großstädtisch sich gibt, stand damals vielleicht eine Torfstecherhütte. Wasserburg gab es, das innumschlungene, und Regensburg zeigte mit mächtigen Quadern und Türmen noch das Bild der Römerstadt, den Lagerplatz der 3. italischen Legion. „Munichen“ aber war noch lange nicht zu finden, und wenn München 1958 mit stolzer Gebärde seine „lumpigen“ 800 Jahre feierte; wir tun so etwas bescheidener, aber auch „mit Herz“, und wir legen dank Ratpot 400 Jahre dazu. Und wenn zu mittelalterlicher Zeit der Herzog von München dem Freisinger Bischof die Salzbrücke wegbrannte, wir Glonner schätzten lieber das Richtfeuer des Freisinger Bergs, das über tausend Jahre der geistigen, der geistlichen und der künstlerischen Kultur unseres Landes leuchtete.
Unter dem Agilolfinger Tassilo (leider steckte ihn König Karl 788 wegen angeblichen Hochverrats in lebenslängliche Klosterhaft) gab es glückliche baierische Jahre; die- Klöster blühten auf und mit ihnen die Wirtschaft. Kirchen und Kapellen mehrten sich, fast alle aus Holz gebaut; erst 200 Jahre später wird der Holzbau vom Bau mit Steinen verdrängt.
Im Jahre 774 geschehen in der Welt noch zwei hier erwähnenswerte Dinge: König Karl zerschlägt das Langobardenreich. Aus dem Lan- gobardischen haben sich in unserer Mundart noch manche Worte erhalten, so das Wort dengg = links (So machte eine Wirtin eine gar einsichtige Bemerkung, als sie bei einem Leichenmahl das allgemeine Lob über den Verstorbenen hörte: „Ja, auf der oan Seitn war er ganz recht, und auf der andern sand mia a dengg!“).
Leichter im Gedächtnis hält sich das zweite Geschehnis: Sechs Monate und drei Tage nach Ratpots Besitzübergabe, am 29. September 774, wird in Salzburg der Dom eingeweiht. Denk daran, mein Landsmann, wenn Du in die Mozartstadt kommst, sag dem Dom, dem Nachbarn aus der frühen Zeit, ein freundschaftliches Grüß Gott und dem Herrgott sag ein Stoßgebet um Frieden für das schöne Land diesseits und jenseits der Salzach und für Glonn, das so alt ist wie Salzburgs Dom!
S. 3
Die Heimat ist älter — Ihre Vorgeschichte
Nun dürfen wir nicht denken, Ratpot und seine Frau, so er eine hatte, wären der Adam und die Eva vom Glonner Paradies gewesen. Aus vorgeschichtlicher Zeit haben uns ja die ersten Menschen unserer Heimat Zeugnisse ihres Lebens, ihres Mühens und ihres Hausens hinterlassen. Und wiederum vor diesen Menschen hat der Schöpferwille mit den Kräften der Urnatur unserem Lande die schönen großen Konturen eingezeichnet.
In drei gewaltigen Zeiten des Untergangs schuf Gott das liebliche Grundbild unserer Heimat. Während einer ungeheuren Einfrierung der Erde schob sich dreimal das Eis der Alpen in mächtigen Decken aus dem engen Tor des heutigen Inntals. Als dazwischen die warmen Winde einbrachen und der Föhn die Orgel blies, den tausendjährigen Winter zu unterbrechen, da trugen urige Ströme den Schutt der Zerstörung ins Land. Mit Schlamm und Lehm vermengt, bildete sich der Nagelfluh, wie er heute in der Schlucht von Altenburg malerisch zu Tage tritt und Gebirgsromantik ins Hügelland zaubert.
Aber wieder kam der riesige Gletscher und seine Brüder ins Feld und wieder erfror die Erde, und wo die Gletscher endeten, legten sie, ein wenig müde von der weiten Fahrt, ihr Schuttgepäck in niedrigen gleichförmigen Wällen ab. Und diese geben den Fluren von Zorneding und Purfing, von Anzing und Schwaben den auch für uns Glonn-verwöhnte noch gefälligen Terrassenreiz. In der dritten und (vorerst!) letzten Eiszeit zog sich die Vergletscherung nicht mehr so weit hinaus. Aber dort wo sie Schluß machte, schuf sie das fantasievollste aller Hügelgelände, ein Bild voller Launen und Scherze, voller Einfall, voller Anmut und Schönheit. Fächerförmig hatte sich der Eiskuchen des Inns noch einmal hinausgeschoben; er schuf die Höhenzüge von Hel- fendorf, Egmating und Oberpframmern, leckte mit einer Zunge bis Buch vor und hinterließ uns, wo später die Abflüsse fehlten, die reizendsten Seen. Das war etwa im zehnten Jahrtausend vor Christus. Und wieder kam der große „Sunnwind“. Das Eis schmolz. Die Moränenhügel überzogen sich mit dem ersten schüchternen Grün der Wiesen. Aus ihren Adern quoll der Bach hervor.
Wie der Boden rasch sich senkt und hebt, da schmiegt er sich anmutig ins Tal, da klimmt er steil empor, da kuppt er sich rund zum Gugelhopf, dort kegelt er sich, hier reißt er schluchtenschmal eine Rinne ein und in einer Wiesenidylle hinterläßt er uns ein Eiszeittröglein voll klaren Wassers mit allzeit grünem Kraut am Grund und voller Sumpfdotterblumengold an seinen Rändern im Frühjahr. Welch jugendliches Gesicht hat doch unsere Landschaft! Und mit Dörfern und Höfen und Kirchen hat doch längst die erhaltene Naturlandschaft sich innig dem Menschenwerke hingegeben und ist Kulturlandschaft geworden.
Aus der Altsteinzeit finden sich bei uns keine Funde, wohl aber in den Anraingebieten auf der Münchner Ebene. In der Jungsteinzeit kamen die Siedler von den waldfreien Lößböden
S. 4
an der Donau und vom tertiären Hügelland bei Landshut, Moosburg und Freising in unser Moränengebiet. Der Mensch wurde seßhaft und blieb länger an einem Ort. Die Funde aus der jüngeren Steinzeit, etwa 4000 bis 2000 v. Chr., stammen hauptsächlich vom äußeren Rande der Gletschermoränen in der Linie Holzkirchen- Glonn – Ostermünchen – Wasserburg. Scherben, Tierknochen und Kohlenreste fanden sich in einem später aufgelassenen Glonner Tuffsteinbruch. 1933 entdeckten wir in der nächsten Nähe des Bahnhofs, hinterm Seiler Eichmeier, eine Wohngrube, von Lehm umschlossene knöcherne Reste von Mahlzeiten, ein Steinbeil und ein Feuersteinmesser. Feuerstein bricht ähnlich wie dickes Flaschenglas und gibt messerscharfe Ränder. Tuffsteine waren in der Grube zusammengetragen worden; sie dienten entweder als Kochplätze oder als erhöhte Lagerstätten. Keramikscherben zeigten einfache Schmuckformen, vielfach das Fischgrätenmuster. Aus der nachfolgenden Broncezeit wurde ein hübscher Krug im benachbarten Aying und verschiedene Gegenstände bei Piusheim gefunden.
S. 5
Kelten und Römer färben uns ein – Bajuwaren sind wir
Das erste Volk in der Vorzeit unserer Heimat, das uns mit Namen bekanntgeworden ist, ist das Volk der Kelten. Diese kamen von der oberen Mosel, dem oberen Rhein und der oberen Donau. Ein unruhiges Wandervolk. Teile von ihm drangen bis nach Britanien und Spanien, bis Italien und Griechenland, bis Kleinasien und an das Schwarze Meer. Nur ihre Sprache läßt sie als Einheit erscheinen. Und aus ihrer Sprache ist unserm Fluß und mit ihm Tal und Ort der Name zugewachsen: Clana, die Klare. Nach dem Jahre 1000 gibt es einen Ortsadel de Clana. Im 14 Jh. findet sich „die kirch St. Johann zu Glan“ und Glan heißt heute noch der muntere Bach, der weit von uns als Nebenflüßchen in die Salzach springt. Im 16. Jh. färbte sich der Name in Glon um und seit dem Dreißigjährigen Krieg schreibt man die zwei nn. In der Mundart heißt es „Gloo“, etwas hart und selbstbewußt und fast wie „Klo“. Und der Hauser von Haus hat es sich nicht entgehen lassen, in seiner „Glonner Schöpfung“, die noch nie gedruckt und in Glonn nur einmal in der Lena-Christ-Stube vorgetragen worden ist, uns ein bißl „zu stroafa” wie er sagt. Freilich, schön klingt auch das hochdeutsche „Glonn“; das klingt tief und summt aus wie die Zwölfuhrglocke, die hier zu Ehren kommen darf, weil sie für uns Ministranten einst „die große Glocke“ war und schon Kraft dazugehörte, sie zu läuten; es ist die Friedensglocke von 1653.
Daß der Namen Glonn seit der Keltenzeit geblieben ist, daß ihn auch die später einwandernden Bajuwaren übernommen haben, ist nach Prof. Torbrügge ein Beweis, daß der Ort nie länger verödet und die Siedlungskette nie länger unterbrochen war. Die Kelten waren übrigens ausgezeichnete „Hand“-werker: Zimmerleute, Gerber, Schuster, Wagner und Schmiede; zur Erleichterung des Handels verwendeten sie schon Münzen.
Aus der Zeit der Römerherrschaft, von 15 v. Chr. bis gegen 500 n. Chr. wissen wir von den großartigen Straßen, welche Augsburg (nach Tacitus die glanzvollste Koloniestadt südlich der Donau und der Sitz des Statthalters) mit den sonstigen Zentren und schließlich mit Rom verbanden. An der Straße von Salzburg über Seebruck nach Augsburg wurde nicht allzuweit von uns bei Helfendorf der berühmte 60. Meilenstein gefunden. Er trägt den Namen des Kaisers Septimius Severus (192 bis 211). Dieser Herrscher stammte aus Afrika. Hannibal war sein Vorbild. Von den Donauländern führte er seine Heere gegen Rom. Der Untergang der antiken Kultur begann. Seine verderbten Söhne dem vergifteten Leben Roms zu entreißen, zog er im Alter gegen Britanien zu Feld. Er war schon gichtbrüchig und ließ sich in einer Sänfte tragen. Auf dem Feldzug starb er.
Römermünzen, in Glonn gefunden, gehen auf die Kaiser Claudius und Nero zurück. Claudius war schwachen Geistes, aber ein durchtriebener Tyrann. 35 Senatoren und 221 römische Richter ließ er hinrichten. Er selber starb am Genuß eines vergifteten Pilzes. Sein Nachfolger und Stiefsohn Nero hielt ihm die Leichenrede. Dessen Schreckensherrschaft ist bekannt. Er endete durch Selbstmord. „Die Glonner“ hatten
S. 6
nur mit seinem Gold zu tun! Die Legionäre, Beamten und Händler aus Rom wollten in der rauhen Provinz nördlich der Alpen auf die zivilisatorischen und kulturellen Errungenschaften ihrer klassischen südlichen Heimat nicht verzichten. So entstand wegen des zunehmenden Bedarfes eine große Töpferei für Terra sigilatta beim heutigen Westerndorf nördlich von Rosenheim. Zwischen Kleinhelfendorf und Schöngeising finden sich noch heute die besterhaltenen Stücke von allen Römerstraßen in ganz Deutschland.
Der romanischen Einmischung schreibt man teilweise die Neigung und Begabung des Altbaiern für das Musische und für die Musik zu. Die Musik aber ist „das königliche Geschenk“ der Altbaiern an die Welt. Haydn, Mozart und Schubert waren mit Überzeugung altbaierische Menschen. „Redn ma soizburge- risch”, sagte Mozart, „dös is g’schickt”. Haydn war übrigens der Sohn eines Hufschmieds und einer Köchin, wie das (was den Vater betrifft, wenigstens standesamtlich) auch bei Lena Christ der Fall ist.
S. 7
Spätestens im 5. Jh. kamen die Bajuwaren oder Baiwaren von Böhmen her ins Land*). Es waren meist getaufte Christen, hingen aber noch der Ehre des Arius an, der die Gottheit Jesu verneinte. Das heute noch im großen Credo gebetete „Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott . . .“ geht bis an das Konzil von Nicäa zurück, das die Lehre des Arius verwarf. Mit den Bajuwaren taucht das baierische Volk in der Geschichte auf. Die Bajuwaren waren nach Benno Hubensteiner „ein Bauernvolk, gutmütig und jähzornig, sinnenfroh und aufwenderisch, eigensinnig und beharrend wie noch heute“. Der baierische Stamm vereinigte dabei in sich Bevölkerungsgruppen unterschiedlichster Herkunft; manche Gruppen scheinen schon vorher in unserem Raum eingesessen gewesen zu sein.
*) Die „ing“-Orte wie Grafing, Alxing, Zorneding, Egmating sind bajuwarische Neusiedlungen.
S. 8
Geschichte bis zum Schluß der Geschichte —
Die Anfänge des Christentums
Bald nach 700 hat der baierische Herzog Theodo den katholischen Glauben angenommen. Aber Christen gab es in Baiern auch schon im 7. Jahrhundert. So haben sich im Jahre 651 200 Männer dem Zuge angeschlossen, der die Leiche des gemarterten Bischofs Emmeram von Helfendorf nach Aschheim brachte. Von Münster darf man annehmen, daß es eine altchristliche Zelle unserer Heimat war. Ein Urkloster dürfte es nicht gewesen sein, wohl aber zu einem Kloster gehörig. Der Flurname Heimeranholz, südwestlich von Münster, verweist vielleicht auf St. Emmeram in Regensburg. Daß die Kirche Johannes dem Täufer geweiht ist, besagt, daß Münster wohl eine Taufkirche war. Die Nähe des Marterortes Helfendorf hat ihm seine Bedeutung gegeben. Da damals das Taufen noch durch Untertauchen im Wasser vollzogen wurde, und da den Glonnfluß sicher eine Verkehrslinie, vielleicht eine Furt, durchquerte, dürfte Glonn, dessen Kirche ebenfalls dem Täufer geweiht ist, Münster den Rang als Taufkirche abgelaufen haben.
Die Kelten hatten auf den britischen Inseln mit großer Leidenschaft das Christentum angenommen und mit dem ihnen eingeborenen Wandertrieb durchzogen sie als Missionare das Frankenreich und kamen später bis ins baierische Land. „Mit langem Haar, mit gefärbten Augenlidern und dem ledernen Quersack auf dem Rücken“ ähnelten sie ganz und gar nicht den sanften und liturgisch-festlich gewandeten Gestalten der malenden Nazarener und nicht denen auf den Bildern der Bibel in unserer Kindheit, wohl etwas mehr schon den wandernden „Blumenkindern“ der 2. Hälfte unseres späten Jahrhunderts. Auch Korbinian, der Hofbischof beim Herzog in Freising, hatte, wiewohl er an der französischen Seine aufgewachsen war, keltisches Blut in sich.
Als Ratpot seine fromme Stiftung tat, war unser Land schon ein christliches geworden, wenngleich manch heidnischer Brauch und Zauber daneben weiterlebte. 771 fand unter Herzog Tassilo II. zu Neuching, zwischen Schwaben und Erding gelegen, eine Synode statt, und im Jahre Ratpots erging an die geistlichen Würdenträger des Landes der Auftrag, dafür zu sorgen, „daß die Priester nicht unwissende Leute seien, sondern die heiligen Schriften zu lesen und zu erfassen vermögen; ein jeder Bischof soll daher an seinem Sitze eine Schule errichten und einen weisen Lehrer bestellen, der nach der Überlieferung der Römer zu unterrichten und Schule zu halten verstehe.“ 804 erließ Karl d. Gr. ein Gesetz, daß Männer und Frauen das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und die Taufformel zu lernen hätten. „Und der sie nicht festhält, soll Schläge bekommen, oder es sollen ihm die Getränke entzogen werden, außer Wasser“. Da das Lateinische zu lernen schwer fiel, wurde 813 hinzugefügt: „Wer es nicht anders lernen kann, möge es in seiner Sprache lernen.“
Wann in Glonn die erste Kirche stand, läßt sich nicht nachweisen. Die Gräberfunde auf dem Bäckerberg (an der Ebersberger Straße) zwischen 1858 und 1937 brachten keine christlichen Zeichen zutage; sie dürften also aus
S. 9
vorchristlichen Zeiten stammen. In Berganger aber schenkten fromme Leute 776 — 78 ihr „Gotteshaus“ dem Bischof von Freising. Doch 821 gibt es in Glonn einen Priester Ratpoto, der seine Wiesen, Wälder und Gewässer der Marienkirche in Freising vermacht. Nach dem Jahre Tausend fallen Bindungen und Stiftungen an das Kloster Tegernsee auf. 826 gibt es in Georgenberg ein Oratorium (das ist ein eingesegneter, aber nicht geweihter Betsaal) und einen Priester Hadhmunt.
Bei dem großen Brand in der Schwedenzeit sind wohl alle damals vorhandenen Aufzeichnungen aus der Glonner Pfarrgeschichte verloren gegangen. So konnte der bienenfleißig sammelnde Pfarrer Niedermair für die Zeit bis zum Jahre 1600 nur 11 Priester in seine Glonner Chronik eintragen, darunter jeweils überhaupt keinen aus dem 10., 11., 12. und 14. Jh. Während in den ersten 8 Jahrhunderten nach der ersten urkundlichen Erwähnung Glonns also nur 11 Priester namentlich nachgewiesen sind, folgen in den 4 Jahrhunderten seit 1600 nicht weniger als 31 Pfarrherrn. Mag in der Geschichte des frühen und auch noch des mittelalterlichen Christentums rund um Glonn vieles im Dunkeln bleiben, der wahre Ursprung liegt fest und Theodor Haecker, der Philosoph, umschrieb ihn 1935, in einer Zeit, da wir Menschen mehr Sinn für das Geschichtsmächtige hatten, mit den Worten: „Die Menschwerdung Gottes ist in sich Geschichte und bleibt Geschichte bis zum Schluß der Geschichte“. Daß sich ein Mönch, der im 6. Jh. den Auftrag bekommen hatte, die Zeitrechnung rückwirkend festzulegen, verrechnet hat (er vergaß das Jahr Null zwischen dem Jahre 1 v. Chr. und 1 n. Chr. einzuschreiben und er übersah jene vier Jahre, da Kaiser August unter seinem eigentlichen Namen Octavian regiert hatte) und Christus um einige wenige Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren sein dürfte, ändert daran nichts.
 Grabstein der Brüder Schmalzmair
Grabstein der Brüder Schmalzmair
S. 10
Hirten und Herren — Auf den Stufen der Pfarrgeschichte
Steigen wir nun auf den Stufen der Glonner Pfarrgeschichte, an Hand der „Herren“ und „Hirten“, durch die Stockwerke der letzten Jahrhunderte bis zur Gegenwart herauf! Wir können nur da und dort verweilen. Da grüßt uns an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit der Dekan Mathäus Renzlhauser; er war wenigstens 27, wahrscheinlich viel mehr Jahre Pfarrer und zeitweise auch Dekan. Als er 1513 stirbt, endet praktisch schon die vorreforma- torische Zeit. — Hinter Pfarrer Korbinian Geisen- hofer lärmen die Trommeln, lodern die Flammen. „Der Schwed ist kumma,/hot ois mit- gnumma, / hot d‘ Fensta eingschlogn; / hot ’s Blei davotrogn, / hot Kugln drauß gossn / und ois verischossn . . .“. Diesen Vers kannten die Kinder noch vor 50 Jahren als Abzählspruch. Der Pfarrer Geisenhofer mußte die Toten der Glonner Bauernschlacht begraben. Er hielts nicht lange aus. 2 Jahre später, 1634, brach ihm das Herz. Nur 4 Jahre war er Pfarrer in Glonn gewesen. — Seine zwei Nachfolger, die Brüder Schmalzmair, Bauerssöhne von Gelting, hatten die Natur, den restlichen Dreißigjährigen Krieg in Glonn durchzuhalten, wiewohl der Schwede und andere Kriegsvölker wieder ins Land kamen. Johann, 1634 bis 1644, hat viele Reliquien nach Glonn gebracht und die Bruderschaft erneuert; seinen Bruder Melchior ließ er 1642 die Primiz in Glonn feiern und behielt ihn als Kooperator. Der „Kröllhans“ von Gelting muß beliebt gewesen sein (in Notzeiten schätzt man immer den „Hirten“ mehr als den Herrn“!); denn er wurde „mit vil Zächern“ beim Frauenaltar begraben. Melchior führte noch 20 Jahre die Glonner Pfarrei. Er schrieb ein vorzügliches Latein. Er ließ in München um 700 Gulden die 12 Zentner schwere Friedensglocke gießen. Er hatte ein ansehnliches Kapital dem Grafen Fugger auf Zinneberg ausgeliehen und stiftete es für wohltätige Zwecke. Bis zur Säkularisation kamen Kirche, Kinder und Studenten in den Genuß der Zinsen. Über seine sehr genauen Aufzeichnungen aus dem Dreißigjährigen Krieg hören wir später.
Franz Kaltner lebte zu Mozarts Zeiten 8 Jahre als Pfarrer in Glonn und war ein von Krankheit gequälter Mann und ein begabter Musikus. Er war des Fürstbischofs von Freising anerkannter Domkapellmeister. Geistliche Musik von ihm ist in den alten Beständen des Klosters Attel wieder aufgefunden worden. Kompositionen aus seiner Feder werden wieder aufgeführt und auch bald auf einer Schallplatte zu hören sein. Wasserburg war seine Heimat. — Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begegnet uns ein fleißiger Chronist, der Pfarrer Benno Amann. Er berichtete aus der Zeit der napole- onischen Kriege. — Ein Pfarrherr voller baju- warischer Tatkraft war Franz S. Vordermayer. Er baute 1842 den heutigen Pfarrhof und den schönen Pfarrerstadel, ein Beispiel alter Zimmermannskunst; er wurde Distriktsschulinspektor, war also geistlicher Schulrat, er gründete Jugendvereine und kümmerte sich um eine Mädchenschule. Fast schade, daß er nur 11 Jahre hier blieb; er starb 1870 in Geisenhausen.
S. 11
 Geistl. Rat Otto Boxhorn – 70 Jahre Priester
Geistl. Rat Otto Boxhorn – 70 Jahre Priester
Geistl. Rat Josef Späth führt uns ins 20. Jahrhundert herauf. Er kam schon 1870 nach Glonn, starb aber erst 1910. Als ehemaliger Görresschüler hatte er auch etwas aus dem Kulturkampf gelernt. Er verwirklichte mit Glonner Bürgern den Bau einer von Klosterfrauen zu führenden Mädchenschule; aber den kommenden Zeiten nicht trauend, ließ er in die Stiftungsurkunde eine Klausel gegen den ev. Abbau der klösterlichen Lehrerinnen einbauen, und so hat er 1937 den voreiligen Gauleiter Wagner gezwungen, das stattliche Haus — es war vor 1914 das schönste und gepflegteste Schulhaus im ganzen Bezirksamt Ebersberg – dem Domkapitel in München zu schenken. Freilich ging es damit der Gemeinde verloren, und das hatte Pfarrer Späth ganz gewiß nicht gewollt.
Ihm folgte, väterlich-mild, von 1910 bis 1934 Pfarrer Schrall. Aber als das „Tausendjährige Reich“ kam, brauchte man einen Kämpfer, der sich nichts ins Bockshorn jagen ließ, und das war der des Wortes so mächtige streitbare Humanist Geistl. Rat Otto Boxhorn. 97 Jahre lebte er, 74 Jahre war er Priester, davon fast volle 40 Jahre in Glonn. Am 27. Januar 1974 starb er, immer noch beweint und viel geliebt. Priester und Prediger war er und sonst nichts, Mahner und Versöhner, Teilhaber unserer Freuden, Tröster in Leiden, ein Mensch wie Du und ich und ein Friedensstifter und sonst nichts. Und das Bonmot, das bei einer Festrede einmal fiel und seitdem nicht mehr unterging, wird man noch lange in Glonn hören: „Was Pacelli für Rom, was Adenauer für Bonn, das ist Boxhorn für Glonn.“
Den Pfarrern von 1951 — 1955 und dann wieder bis 1971, Alois Raab und Josef Loithaler, werden wir noch bei der so verdienstvollen letzten Kirchenrestaurierung begegnen*). Das Jubeljahr 1974 aber segnet uns unser neuer Pfarrer und Dekan Josef Schneider ein. Mögen ihm seine junge Manneskraft und seine Freude am Werk lange treubleiben! Ein Jahrtausend geht zu Ende!
*) Pfarrer Loithaler hat sich mit Erfolg auch für die Restaurierung der Filialkirchen eingesetzt.
S. 12
Langer Lohn — Die Geschichte des Kirchenbaus
Früher war man der Auffassung, daß 1632, als der Ort „bis auf ein badstuben“ niederbrannte, auch die alte gotische Kirche untergegangen sei. In den Handakten und Archiven findet sich- aber kein Hinweis auf einen Neubau der Kirche nach 1632, und schon 1642 wurde in Glonn die Firmung gespendet. Die heutige Sakristei ist noch ein Stück der alten gotischen Kirche. Es war ihr Altarraum. Die Anlage hat die Form eines Achtecks; in der oberen Sakristei ist das alte Gewölbe erhalten; die Rippen sind einmal abgeschlagen worden. Der 1973 zu früh verstorbene und Glonn besonders zugeneigte Heimatpfleger Dr. Heinrich Kastener fand 1966 1,20 m unter dem Sakristeiboden Spuren eines alten Estrichs und romanische Bauelemente, er nimmt deshalb an, daß die Kirche mindestens seit romanischer Zeit inmitten des Ortes stand.
Nach 1760 befand sich die Kirche in einem so ruinösen Zustand, „daß der Gottesdienst nur mit der größten Gefahr gefeiert werden kann“ (Bittschrift an den Kurfürsten!). Ein Neubau war nicht mehr aufschiebbar. Der Graf Fugger gab 200 Gulden, die Gemeinde sammelte 600, „wozu die Dienstboten viel beigetragen haben“; eine schöne Kirche ist gerade für arme Menschen ein Anlaß zu Freude und Stolz, eine festliche Stube und ein Vorsaal zum Himmel. Die Kirche zu Wolfratshausen mußte der Pfarrei Glonn Geld leihen. Als Sicherung galt ein großer Glonner Tuffsteinbruch. So führten denn die Loisachmärktler aus dem Glonner Bruch Tuffquader für ihren eigenen Kirchenbau fort, obwohl man die Steine recht notwendig in Glonn selbst gebraucht hätte.
1767 wurde das alte Langhaus abgebrochen. Bei der Grundaushebung stieß man auf eine mächtige Tuffbank; hocherfreut brach man zehn Klafter Stein heraus, kam aber dann auf weiches Erdreich und mußte nun sehr viel tiefer fundamentieren. Kein Wunder, daß erst 1823 die Kirche geweiht werden konnte und daß vorher die verantwortlichen Bauleute schier wie früher die Dienstboten an Lichtmeß wechselten. Da gab es einen Maurermeister Haller von „Nurdhoffen”; einen Zimmermeister Wäsler (das Geschlecht der Wäsler ist heute in Glonn und dem Umland weit verzweigt), er fertigte den Dachstuhl des Langhauses; die 727 genehmigten Gulden reichten nicht mehr für den Chor und die Turmkuppel. Da lieferte der „Haidten“ von Schwaben einen Voranschlag. Der Bau blieb stecken. Der Hofmaurermeister Leonhard M. Gießl findet bei einer Besichtigung das Gewölbe noch nicht angefangen, den Turm erst bis zur Höhe des Langhauses aufgeführt. Das Gerüst fing zu faulen an, im Winter standen die Besucher der Messe oft bis über den Fuß in Schnee und Wasser. Der Gießl freilich wäre für Glonn schon recht gewesen; als Wiener kam er aus der Schule des großen deutschen Barockbaumeisters Lukas von Hildebrandt; er baute in Starnberg eine der schönsten Landkirchen des späten Rokokos und bei Dietramszell mitten in die Wiesen- und Wälderlandschaft eine der entzückendsten kleinen oberbayerischen Wallfahrtskirchen, St. Leonhard. Hätte Gießl den Bau in Glonn vollendet, wäre unser Turm von ihm wohl ähnlich
S. 13
 Bild S. 14 Ein Bild von Magnus Meßner
Bild S. 14 Ein Bild von Magnus Meßner
wie sein Turm in Sandizell in gemessenem Schwung reizend bekuppelt worden. Und der dichtende Hellmut von Cube – er lebte nach dem letzten Krieg oben in Balkham – hätte seinen liebenswerten Essay über Glonn im Jahre 1949 nicht mit einem Schuß ins Schwarze enden lassen können: „Nur eins ist ein Kreuz und ein Jammer, eine Schmach und eine Schande: das spitze Kirchturmdach, dem schönen Bau unselig aufgepfropft. Da hinauf gehört wieder eine Zwiebel, punktum.“ Aber nicht einmal der baufreudige Willensstärke.
S. 14
Pfarrer Loithaler hat es gewagt, wieder eine Kuppel zu bauen. Freilich jener Kuppel, die man 1870 verdrängte, ist auch nicht nachzuweinen; sie war nicht mehr als ein Notdacherl, „zusam- mengedätscht“ wie ein selbstgestricktes Dirndl- winterhauberl, bei welchem zu früh die Wolle ausgegangen war. Aber 1908 haben sich unsere Baierer Nachbarn beim Bau ihrer schönen neubarocken Kirche — der Glonner Pfarrer Späth, das sei hier nachgetragen, war Pate gestanden — schon eine andere Kuppel geleistet. Mir träumte neulich: Wenn Friede bliebe und gute Zeit, wärs an der Zeit, für unsere zwölfhundert Jahre auf dem gesegneten Boden der Heimat, ein Zeichen des Dankes zu setzen, es müßte dieses Zeichen nicht unbedingt eine Turmkuppel sein. Was bleibt denn schon von Jubeljahren?
Für den vielbeschäftigten Gießl war Glonn nicht lohnend, 1766 machte deshalb der Maurermeister Franz Ant. Kirchgrabner einen Plan zur Fertigstellung der Glonner Kirche. Auch er war wie Gießl ein Österreicher; er kam nach München und übernahm dort das Meisterrecht des großen altbaierischen Baumeisters Joh. Mich. Fischer. Er ehelichte dabei nicht die Witwe Fischers, wie es im Barock üblich und für die Entwicklung der Kunst recht gesund war, sondern deren Base, die wohl etwas jünger war. Norbert Lieb meint, daß auch die Gewölbegestaltung in Ebersberg ein Werk Kirchgrabners sein könnte. Unter Kirchgrabner schritt der Glonner Kirchenbau rasch voran. Das Langhaus bekam ein Latten-, der Altarraum ein Ziegelgewölbe, das Schiff ein flächenhaft verkümmertes Wandpfeilersystem. Glonn stellte Kirchgrabner ein sehr ehrendes Attest aus, er habe den Bau mit Sparsamkeit veranstaltet und alles auf einen vollkommenen Stand gebracht. Kirchgrabners Kirchen in Mattighofen bei Braunau (1774 — 79), in Eschenlohe im Wer- denfelser Land und in Egling bei Landsberg zeigen den Nachfolger Fischers als dessen guten Nachklang. Aber während Kirchgrabner in Eschenlohe und Egling noch namhafte barocke Freskanten zur Ausschmückung gewinnen konnte, ließ Glonn erst 1823 durch den Maler Joh. B. Beham aus Aibling Deckenbilder malen. Aber die große Zeit der Freskomalerei war längst vorbei und so ist es glaubhaft, daß Lehrer Dunkes recht hatte, als er um 1860 in seine Aufzeichnungen schrieb, daß die Bilder in sehr „mittelmäßiger Arbeit“ verfertigt wären; sie wurden 1894/95 ersetzt. Die große Zeit der glonngebürtigen Maler Beham lag eben im 18. Jahrhundert. Davon werden wir noch hören.
Im August 1823 wurde die Kirche vom Erzbischof Freiherr von Gebsattel geweiht. 1973 gedachte man in einem Kirchenkonzert feierlich und würdig des Tages, da vor 150 Jahren jahrzehntelange Kirchbausorge endlich ihren Lohn fand.
1969 aber schuf sich die evangelische Gemeinde nahe dem „Kugelfeld“ ihre moderne Rundkirche und die Katholiken stifteten eine wertvolle Altarbibel dazu. Eine neue Zeit!
S. 15
Joseph Götsch — Ein tragisches Leben und sein Werk für Glonn
„Die Kunst setzt Gottes Schöpfung fort“ (Leonardo da Vinci). Sie bindet uns an den Ursprung alles Schönen. In der Provinz ist es vor allem die Kunst der Kirchen. Kirchen heben das Land aus seiner Dumpfheit. Ihre Türme sind der Orte Wahrzeichen.
In Dehios „Handbuch der Kunstdenkmäler in Oberbayern“ wird die Kirche St. Johannes Bapt. zu Glonn mit ganzen vier Zeilen bedacht. Das Buch ist freilich schon 1952 erschienen. Erst zwei — drei Jahre vorher entdeckten meine Schulbuben auf dem Langhaus der Kirche große und kleine Holzplastiken aus dem 18. Jh. Staub und Fledermäusekot hatte sie begraben. Zwei kunst- und kircheninteressierte Glonnerinnen holten mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen einen Petrus und einen Paulus aus ihren Schmutzpanzern. Die anmutige Krönungsmadonna stellten sie sogleich in den strahlenden Feldblumenjubel ihres Prozessionsaltars. Pfarrer Alois Raab erlaubte den ersten Wiedereinzug der aufgefundenen kostbaren Figuren ins Kirchenschiff. Der Maler Prof. Sepp Hilz erkannte sie als Werke des rühmlichen Rokokoschnitzers Joseph Götsch. Die Restauration von 1958, der Pfarrer Loithaler seinen Willen lieh, hat mit den Irrtümern der Restauratoren des 19. Jahrhunderts aufgeräumt. Die Gestalt des Hochaltars, die den Seitenaltären von Rott a. Inn nahegekommen sein dürfte, war nicht wieder aufzubringen. Der ursprüngliche Tabernakel ging verloren. Wohl oder übel mußte man sich auch für das Dreiviertelrelief der Taufe Jesu mit einem neuen, sachlich-nüchternen Gehäuse begnügen, welches aber die plastische Szene zu sehr von den zwei großen und großartigen Apostelgestalten trennt. Auch der landschaftliche Hintergrund ist nur zum Teil noch original.
S. 16
Im Auszug hat Götsch die Krönung Mariens dargestellt. Voller Liebreiz ist die Knieende. Unsere Vorfahren müssen gerne zu ihr aufgeblickt haben; denn viele weinten, als man sie in einer unkünstlerischen Zeit aus dem himmlischen Gewölk herniederholte und sie in die düster-dämmerige Austragsstube des Langhausspeichers verwies. Fachkundige schreiben der Madonna die Anmut der Wiener Schule um Raphael Donner zu, dessen Werk Götsch in seiner Jugend kennengelernt hatte. Um die Schönheit der beiden Apostelfiguren genau zu sehen, mußt Du Dich einmal vorne und an ihre Seite begeben. Wie schön sind etwa die fein- gliedrigen, in den Fingern sich spreizenden Hände; wie schmiegt sich der Kreuzesstamm Petri an die Bewegung des Körpers; Blick und Geste der zwei Heiligen wenden sich väterlich und zur Hilfe bereit den Gläubigen zu. Hier sind wir den meisterlichen Werken des J. Götsch in der Klosterkirche zu Rott sehr nahe. In Rott hat der sich in Aibling niedergelassene und aus dem ötztal stammende Tiroler Künstler neben dem größten Genie der deutschen Holzschnitzerei des 18. Jahrhunderts, neben Ignaz Günther, selbständig arbeiten und bewähren dürfen, und nicht, wie so oft falsch berichtet wird, als dessen bloßer Geselle. (Damit man unterscheide: Die gesundbackigen Engel auf dem Gebälk sind aus dem 17. Jahrhundert und also nicht von Götsch).
 J. Götsch: Kruzifix mit Schmerzhafter Muttergottes.
J. Götsch: Kruzifix mit Schmerzhafter Muttergottes.
S. 17
Das wundervolle Götschkreuz mit der schmerzhaften Madonna hat nie ins Gefängnis des Speichers gemußt. Wann hätten jemals Mütter auf eine Mutter der Schmerzen verzichten können? In überlängten Formen ist die Gruppe (an der Nordseite des Schiffes) geschaffen. Christi Antlitz ist fast schon der Marter entronnen und schon heimlich dem Hellen und Heiteren verwandt. Adelheid Unger, die wie sonst niemand das Gesamtwerk von Götsch kennt, weiß es: „Götsch hat diesen Ausdruck vorher und nachher nie wieder erreicht.“
Adelheid Unger ließ 1972 im Verlag H. Konrad, Weißenhorn, eine hervorragende, textzuverlässige und überaus reich bebilderte Götsch- monographie erscheinen, deren Herausgabe neben anderen Gemeinden und Institutionen anerkennenswerter Weise auch die Marktgemeinde Glonn unterstützte und förderte.
Götsch persönliches Leben war wahrlich kein Honiglecken. Vor seiner Niederlassung in Aibling 1759 muß er beweisen, daß seine Kunst „guett und Architekturmessig“ sei. Unbegabte Konkurrenz und Unglück im Leben machen ihm Schwierigkeiten. Bald stirbt ihm seine Frau. Drei Jahre später wird ihm in München ein uneheliches Kind geboren. Noch gibt ihm eine Aiblinger Bürgerstochter das Jawort für eine neue Ehe. Aber Götsch verfällt allmählich der Trunksucht und der Armut. Wer weiß, was zuerst davon dagewesen sein mag? Im Alter muß er sich wehren gegen den neuen Geschmack, der von oben verordnet wird, der „edle Simplizität“ verlangt und sich gegen „ungereimte Zierarten an Kanzeln und Altären“ wendet. Zuletzt hatte Götsch nichts mehr als seine endende Kunst und seinen siechen Körper. 1793 stirbt er im Alter von 65 Jahren. Seine 2. Frau verdingt sich als Kindsmagd. Sein Sohn wird Schäffler. Seine Tochter stirbt 1823 wenige Wochen vor der Glonner Kircheneinweihung unverheiratet an Atrophie im Armenhaus.
 Maria Krönung von J. Götsch im Auszug des Hochaltars
Maria Krönung von J. Götsch im Auszug des Hochaltars
S. 18
 „Johannes soll er heißen“ — Deckenbild von Lessig und Ranzinger, 1893
„Johannes soll er heißen“ — Deckenbild von Lessig und Ranzinger, 1893
Hell aber flutet das Licht durch die Butzenscheiben der Glonner Kirche, und seit Götsch wieder in ihr eingekehrt ist, gehört sie zu den schönsten und heitersten Landkirchen zwischen der Isar und dem Inn.
Die heiligen Frauen auf dem Marienaltar, vom Schönheitsideal der Renaissance geprägt, die leider einmal bei einer Restauration falsch verschönte hohe spätgotische Madonna, der faltenschön und innig-würdig auf seinem Thron sitzende Andreas, der rotmarmorne gebuckelte Taufstein von 1529, ja selbst der gutkopierte Rokokokreuzweg, der seinen Allerweltsvorgänger verdrängte, klingen gut zusammen. Und gut ist es, daß man 1893 für neue Deckengemälde aus dem Leben des Täufers gewandte akademische Maler, Lessig und Ranzinger, verpflichtete. Da sind wir noch einmal gut davongekommen. Verlorengegangen sind möglicherweise Götsch’sche Beichtstühle. 1782 schrieb nämlich der Pflegekommissar von Schwaben an den Kurfürsten, daß einige Guttäter mit großen Kosten Beichtstühle und Altäre beigeschafft haben, die aber durch das undichte Dach „zusammengeworfen“ würden. Unter den Guttätern darf man auch den Grafen Fugger von Zinneberg vermuten, beruft sich dieser doch einige Jahre später darauf, daß man die Glonner Kirche mit mehreren Familienvermächtnissen bedacht habe. Über die Grabdenkmäler der Kirche ist an anderer Stelle zu lesen. Daß wir Glonner übersehen haben, die zauberhaftschöne duftige Himmelfahrt Mariens in der Mädchenschule zu retten, reut mich schon über die Maßen. Das Bild ließ die Gräfin Johanna von Haimhausen, Gemahlin des Grafen Fugger, durch den begabten Maler Ignatius Oefele für die Schloßkapelle in Zinneberg malen. 1900 wurde das Bild nach Glonn gebracht und, so war es sicher gemeint, für alle Zeiten den Glonnern gestiftet.
S. 19
„Eh ma si’ umschaugt” — Erinnerungen im Glonner Friedhof
„Eh ma si umschaugt / eh ma si b’sinnt, / vatrenzt ma sei Lebn, / ois vatrogats da Wind.“ Das ist ein gar richtiger altbaierischer Vers. Und wenn Du im Friedhof so ein wenig Namen und Daten auf den Steinen liest, steigt versunkenes Erinnern wieder auf. Ja, wo die Toten ruhen, wird die Geschichte wach und wäre es nur die der letzten 70 und 80 Jahre. Die Glonner haben mitten im Ort die Toten zu Nachbarn behalten und so gehen sie unbekümmert an den Hügeln vorbei, von Straße zur Straße, zur Kirche und zu des Alltags Geschäften. Das Feld der Toten wird am Allerheiligentag zur Stätte der „Landsgemeinde“, wo wir uns mit den Fortgewanderten treffen, mit denen über und unter der Erde. Und an Weihnachten, in der Mettennacht, wirft ein Meer von Kerzenlicht seine Wellen wunderbar warm an den Mauern der Kirche empor.
Am Mattenhofner Holz hat die Gemeinde dieser Jahre einen großen schönen neuen Friedhof bauen lassen, im Sommer von Sonne und Weite geprägt, von Waldschatten berührt und von ungezählten geflügelten Sängern vom Morgen bis zum Feierabend fröhlich übersun- gen. Das Glonner Herz aber hängt noch an der vertrauten Enge des Ortsfriedhofs, das ist halt noch der gewohnte „Gottsacker“, die alte liebe Nachbarschaft, wo jeder Glonner den Ruheplatz der hinübergegangenen Lieben findet und wo auch noch der einsamste Glonner ganz gewiß genug alte Freunde anzutreffen weiß.
Schau Dich nur einmal an den vier Eingängen um! Da liest Du, vom Marktplatz herkommend, auf einem Stein den Namen des Lehrers Alexius Strauß, der immer seine hundert Kinder in der Klasse hatte, dazu den Organistendienst und die Gemeindeschreiberei, der fleißig auf die Jagd ging und auch noch deutsche Philosophen las. Wieviel Zeit hatten doch damals noch Leute ohne Zeit! Fernseher hatte er keinen. Und wie seine Grabnachbarin, die Oberin Bernardine Ausberger, die ein ganzes Fünftel der 300-jährigen Glonner Schulgeschichte mitlebte, ist er einmal Ehrenbürger geworden.
Kommst Du im Osten vom Steinberger herauf, so wisse, daß nahe dem Eingang der Pfarrer Späth dem prächtigen Großvater der Lena Christ die zu Ruf gekommene rühmende Grabrede hielt. Pfarrer Späth konnte übrigens auch kurz sprechen. So sagte er einmal am Grabe eines Burschen nur die 3 Sätze: „Loben kann ich ihn nicht. Tadeln darf ich ihn nicht. So geb ihm der Herr die ewige Ruhe!“ — Nahebei ruht der Gendarmeriekommissar Laubmeier. Seine ungebrochene bajuwarische Gradheit hat ihm in den bekannten „tausend Jahren“ zwei Versetzungen eingetragen. Erst 1945 durfte er wieder in sein Glonner Haus zurück. Meine Freunde danken es ihm noch heute, daß er ihr Treffensnest beim Doveicht in Krügling trotz aller Anmahnungen nie ausgehoben hat und herzlich hat er gelacht, als er sie einmal singen hörte: „Wir traben in die Weite. / Das Fähnlein steht im Spind. / Millionen uns zur Seite, / die auch verboten sind.“ Und wieder in der Nähe ist unterm Schutzmantel der Madonna in einer künstlerisch feinen Gruppe die Familie Lebsche betend vereint.
S. 20
 Soldatengräber des II. Weltkrieges mit Gedenktafeln für die Glonner Gefallenen
Soldatengräber des II. Weltkrieges mit Gedenktafeln für die Glonner Gefallenen
Trittst Du vom Norden her ein, so salutiert in der Erinnerung der alte Gendarmeriekommandant, der am 26. Mai 1894 mit seinen Gendarmen in Paradeuniform den ersten Glonner Zug empfing. Sein Richtspruch war: „A Schandarm hot zwoa Augn, daß er olle zwoa zuamacha ko“. Streitenden Parteien empfahl er: „Schlogts Eure Köpf zsamm, aber gehts net zum Advo- katn!“ Als in der Morgenfrühe eines Pfingstsonntags der junge Neuwirtsknecht das Soa- lerwegl vom Glonnbach heraufkam (er war von den Fischern hingehängt worden), fragte ihn der Kommandant, was der Guste denn am Bach drunten gemacht hätte. Der Gustl sagte: „D’Socka hob i g’waschn“. „Ja, do hängan s’mit de Schwänz scho raus, deine Sockn“. Der Kommandant schlug ihm ein Paar schöne Forellen links und rechts um die Backen. Angezeigt hat er den Gustl nicht und solange dieser lebte, hat er meinem Vater immer seine überströmende Sympathie zugewandt. – Nahebei erinnern Gräber und Grüfte an die Herren von Zinneberg und an ihre Diener.
S. 21
Am Eingang beim neuen Leichenhaus liegt die im Herbst 1951 eingeweihte Gräberreihe der im letzten Krieg im Lazarett Zinneberg verstorbenen Soldaten. Darüber sind auf großen Tafeln die Namen aller Glonner Gefallenen eingeschrieben. Im Winkel davor hat Glonn in einem spontanen Entschluß, dem an Weihnachten 1951 plötzlich verstorbenen General der Flieger Karl Koller, dem letzten Generalstabschef der Luftwaffe und dem einstigen Glonner Schulbuben, ein Ehrengrab bereitet.
Und gehst Du weiter durch den Friedhof, wieviel schöne Geschichten gab es zu erzählen (und zu erhalten!), erinnert mich ein Stein etwa an den alten Huberwirt, an den Schuaster Sepp, den Dorfpfiffikus, den alten und den jungen, an den Waslmüller, an den Wagner Marin, an den prächtigen Wiesmüllerlenz oder an den Engelbert Moosbauer, der seine Witze über jeden Festabend wie scharf-süßen Zimmt auf einen saftigen Zwetschgendatschi streuen konnte. Übrigens hat er uns alle einmal bei einer Versammlung mit dem Landtagspräsidenten Hundhammer entzückend hereingelegt.
Niemand wollte sich zur Diskussion melden. Da erhob sich der Engelbert, es war einige Tage vor der Landtagswahl, und sagte mit geheucheltem Ernst: „Sehr verehrter Herr Präsident! Ich kann leider nicht lange reden. Ich muß meine Stimme schonen. Ich muß sie nämlich am Sonntag abgeben!“ Das Eis war gebrochen und nun hatten genügend andere Mut, um mitzusprechen.
 Grabtafel eines Veterans von 1866 und 1870/71
Grabtafel eines Veterans von 1866 und 1870/71
S. 22
An den Außenmauern der Kirche finden sich alte Grabtafeln, so für den Wundarzt Joh. Gg. Mayr, der ein großer Wohltäter für die Gotteshäuser in Weiterskirchen, Frauenreuth und Glonn war und ein Freund der schönen Künste. Im Sterbebuch und auf der Gedenktafel fehlen die Sterbedaten. Wahrscheinlich ist die Familie Mayer etwa 1853 von Glonn weggezogen. Daneben wurde der erste praktische Arzt von Glonn, Xaver Gregor, 1861 bestattet. Eine Tafel erinnert an den Maler Magnus Meßner, der 1858 die Kirche um 2500 Gulden restauriert hatte und kurz darauf starb. Eine Tafel erinnert an den Bürgermeister Sebastian Türk, unter dessem frischen „Siebziger-Kommando“ der Glonner Veteranenverein seine glorioseste Zeit erlebte.
Das schönste Grabdenkmal in der Kirche selbst ist der Rotmarmorstein für Warmundt von Pienzenau (t 1596), dem letzten derer von Zinneberg; das älteste ist am Südeingang, die Tafel für Dekan Renzlhauser (t 1513); das ehrwürdigste aber ist der Stein für die beiden tapferen Pfarrer und Chronisten des Dreißigjährigen Krieges Johann und Melchior Schmalzmair am Nordeingang der Kirche. An den Pfeilern, welche den Chorbogen tragen, finden sich Epitaphs der Grafen Kajetan (f 1791) und seines Sohnes Johann B. Fugger (f 1795), „in der blüth eines Alters von 27 Jahren“. Das Geschlecht der Fugger auf Zinneberg ist erloschen.
In der Kupferkuppel des schmucken Dachreiters auf dem Leichenhaus haben 1948 der Meister Alfons Strauß und sein Schwiegersohn Erwin eine Urkunde eingeborgen, in der manches Ergötzliche aus jenen Jahren in Reimen aufgeschrieben bleibt.
 Kreuz auf dem Kugelfeld aus dem Dreißigjährigen Krieg
Kreuz auf dem Kugelfeld aus dem Dreißigjährigen Krieg
S. 23
Glonner Welt- und Kriegsgeschichte
1648 wurde die Wirtin Magdalena Zächerlin begraben. 1960 hat man ihren Grabstein wieder gefunden. Von ihr hatte Pfarrer Schmalzmair viel Lobenswertes zu berichten. Sie hat des Krieges Wunden geheilt, wo immer sie konnte. 26 Wochen war sie selbst auf der Flucht. Als Friede wurde, starb sie. Freund und Feind nährten sich vom Krieg, Feind und Freund bezogen in unserm Lande Winterquartiere. 1632, so schrieb es uns Pfarrer Schmalzmair auf, hat „der Gustav Khinig aus Schweden das Land mit seiner Kriegsmacht durch Rauben und Brennen sehr verderbt“. Glonn wurde bis auf eine Badstube abgebrannt. Später kam die Not durch die Hispanier. 1636 ist „der große sterb“ gewesen; „da hatten wir Hundstage bis nach Lichtmeß“. 1646 geschah – wie 300 Jahre später wiederum — große Flucht von München nach Glonn. Schweden und Franzosen kamen abermals nach Bayern. Als seinen Brüdern in Gelting an einem Tag 6 Rösser abgenommen wurden, verfaßte er ein langes Gedicht: „Des Clagens werd kein endt / wan Gott den Khrieg nit wendt, / der ander Leith getrost soll haben, / thuet ietz am maisten selbst verzagen.“
In dem Totenbuch der Pfarrei Au bei Aibling findet sich eine genaue Aufzeichnung über den tragischen 25. Mai 1632, da Glonn unterging und auf dem Kugelfeld (unterhalb Baikam) „vil der bauren wacht umbracht worden ist“. Damals sind aus den Kirchtrachen um Au 23 Männer in Glonn zusammengehauen worden; es waren Bauern, ein paar Maurer, ein Weber, ein Schuster. „Hanns Springer hat einen Bettelbuben geschickt, ist auch geblieben.“ Auch in Elbach sind über 20 Tote der Glonner Bauernschlacht aufgeschrieben worden. Man hatte den Schweden wohl die Lust austreiben wollen, noch weiter brandschatzend ins Land zu ziehen. Die Gefallenen wurden teilweise in ihrer Heimat begraben, „die andern theils zu Kreuz, zu Glon und Reith (= Frauenreuth) und daselben Orten.“ Die Geduld der Bauern mit all der Soldateska war erschöpft. Immer wieder rotteten sich Bauernhaufen zusammen. In einem Bericht an den Kurfürsten wird ein Jahr später ein Bauer aus Wildenholzen als Anführer genannt. Er hatte „eine rote A-Ia-Mode- Haube, ein ledernes Kleid und einen grauen Mantel und war ganz wie ein Soldat ausstaffiert“. Dazu bemerkte am Rand der Kurfürst eigenhändig: „Rädelsführer! Woher die Musketen?“ Am 7. Januar 1634 berichtet der Graf von Zinneberg, es wären bei seinem Schloß etwa 3000 Bauern gelagert. Endlich kam der Friede, und der Glonner Pfarrer schreibt: „Es ist doch wieder gut geworden“.
Die Türken bedrohten ab 1662 wiederum Heimat und Christentum. 1682 wird Wien zum zweitenmal belagert. Aber da gab es den Prinz Eugen und „den blauen König“ aus München, Max Emmanuel. Dieser war bei aller barocken Großmannssucht so recht nach dem Herzen des baierischen Volkes. 1683 erschien er vor Wien und mit seinen Arco-Kürassieren brach er als erster ins Türkenlager ein. Als es weiter nach Ungarn hineinging, als Budapest erobert wurde (als die Siegesbotschaft in unser Tal kam, sollen kranke Leute vor Erleichterung des Herzens wieder gesund worden sein) und
S. 24
als Belgrad erstürmt war, sang man im baieri- schen Lager längst das Gstanzl: „Da. Kurfürst aus Boarn / is a rechtschaffner Mp, / is lang nit dreißg Jahr, / hot vui dabei to“. Von Was- serburgs Ufern fuhr Jahr für Jahr eine weißblaue Flotte die Donau hinunter.
Der Glonner Pfarrer Wolfgang Gebhard schrieb 1686 und 87 in gutem Latein Hexameter ins Glonner Taufbuch, pries die Siege der abendländischen Heere und dankte Gott, „der alles Gute den Unsern, dem Feinde aber nur Kriege gebracht hat“. Ein halbes Jahrhundert später malt der große Freskant Joh. B. Zimmermann auf die Decke der Dorfkirche in Emmering bei Aßling auf einem seiner Bilder den österreichischen Doppeladler, darunter einen Feldherrn und Papst Innozenz XI.; im Hintergrund aber leuchtet der Stefansturm auf die Zeltstadt der Türken.
Ob viel früher, im 10. Jahrhundert, die Ungarn unsere Heimat durchritten haben, ist nicht überliefert. Die Gegend von Holzkirchen sollen sie verwüstet haben und Ebersberg vergeblich belagert. Einige Buben brachten 1916 dem Lehrer Ursprung kleine Hufeisen mit, die sie in Torfgräben der Filze gefunden hatten.
In der napoleonischen Zeit schrieb Pfarrer Amann, daß einige Glonner in Tirol ihr Leben lassen mußten, daß die Heimat unter den ständigen Requirierungen zu leiden hatte, fügte aber nicht ohne Stolz hinzu, daß „der Korse mit Adlers Fittichen“ herbeigeeilt wäre und Schlacht um Schlacht gewonnen habe und mit Genugtuung stellt er fest, daß Napoleon den Baiern alle Kanonen zurückgegeben habe, die Österreich ihm abgenommen hatte. Noch hatte man ja bei uns nicht vergessen, daß die Österreicher ein paar Jahre vorher Karl Theodor das ganze baierische Landl hatten abhandeln wollen.
Im Kriege 1870/71 blieben 5 Glonner in Frankreich liegen, darunter die zwei Seilerbuben Ludwig und Alois Eichmaier und der Schmiedsohn Josef Singer von Westerndorf. Ein Seiler Eichmaier wurde nach dem 2. Weltkrieg Glonns erster wieder freigewählter Bürgermeister und aus der Singerfamilie stammt unser gegenwärtiger Gemeindechef. Gefallen ist 1870/71 auch der Tambour des kgl. bayer. 11. Inf. Reg. Otto Zuruck aus der Filzen.
Im ersten Weltkrieg hat die Heimatgemeinde 335 Krieger ins Feld geschickt; 71 kamen nie mehr zurück. Von 1939 bis 1945 zählten wir 528 Kriegsteilnehmer und 127 Gefallene und Vermißte. Und 1954 bekannte Professor Leb- sche, dieser konsequente Gegner jeder Diktatur: „Wer hätte schon in unser Talschaft den Krieg gewünscht? Aber denen, die ihre Heimatliebe unter letzten Beweis gestellt haben, versprechen wir, daß wir sie nicht schmähen lassen.“
Liebe und Legende haben sich um den Schmied-Wasler-Hans von Glonn angenommen, der 1915 die Goldne Tapferkeitsmedaille erhielt und nach dem Kriege nach Bart und Gewand einer sehr frühen Zeit anzugehören schien und der doch gescheit und gebildet war und der lateinische Oden fehlerfrei aufsagen konnte und der unter seinem rauhen Fell ein kindlich-gutes Herz schlagen hatte.
S. 25
Glonns Schulen und ihre Herbergen
Soweit die Glonner Tauf- und Sterbebücher zurückreichen, lassen sich immer wieder Lehrer in Glonn nachweisen, obwohl erst 1770 die erste große Schulreform Bayerns unter dem kurfürstlichen Schulkommissär Heinrich Braun ansetzte. Dieser, ein geborener Trostberger, war Benediktiner in Tegernsee, dann Professor an der Akademie der Wissenschaften in München und Domkanonikus. Sein Schulplan macht die erste bayerische Elementarpädagogik aus. Er erkannte: „Eine gute Schuleinrichtung braucht gute Lehrbücher, tüchtige Lehrer und eine gute Lehrart“. Seine im Ansatz guten Reformen sind teilweise dann nur mangelhaft durchgeführt worden. Bei der Eröffnung des ersten Lehrerseminars 1803 (sein Besuch war für den Beruf noch nicht verpflichtend) sprach man in der Festrede „von der siebenfachen pädagogischen Nacht, die Lehrer hält man noch immer für die niedrigsten, entbehrlichsten Leute unter dem Landvolk, zu denen man die Kinder nur so lange zu schicken hat, als es keine Eicheln zu sammeln, keine Ähren zu lesen, kein Vieh zu hüten gibt.“ Der Zwang zum Besuch einer Volksschule wurde erst 1802 eingeführt.
Vorher waren es vielfach Schuleremiten, welche für allergeringsten Lohn, Unterricht erteilten, so z. B. in Kleinhöhenrain, in Hohenthann, in Egmating und in Feldkirchen. Die Kinder von Schlacht besuchten teilweise die „Klause Sommergrün“ im Wald bei Pframmern; wohl nicht allzugern, weil sich der Eremit von 1802 „etwas grob gegen Kinder und Eltern“ erwiesen hat. Nach seiner Prüfung in München wurde vermerkt: „ . . . ein solcher Stümper ist nicht länger mehr zu brauchen; er ist der Pension würdig“.
In Glonn selbst sind im 17. und 18. Jahrhundert wenigstens 10 Lehrer namentlich nachweisbar. Der erste war Balthasar Katzmair, f 1642; er war Richter in Marktl unter Herzog Albert, (also wohl ein angesehener und allgemein gebildeter Mann!) und dann Cantor et Ludima- gister“ in Glonn. Vielleicht hat ihn der Graf Fugger hergeholt.
 Das alte Schulhäusl an der Kreuzstraße, 1813-1838
Das alte Schulhäusl an der Kreuzstraße, 1813-1838
S. 26
Im Jahre 1803 stand, nach den Aufzeichnungen des Lehrers Dunkes (1840 bis 68 in Glonn), ein erstes Schulhaus „dem jetzigen Krämer zum Steinberger vis a vis, eine elende Hütte“. Und Pfarrer Amann bemerkt, daß das Haus so unzweckmäßig und ruinös wäre, daß es den Namen Schulhaus nicht verdiene. 1813 wurde am Platz des alten Austragshäusls zum Steinberger ein neues Schulhaus erbaut, 100 Kinder hatten (natürlich entsprechend zusammengepfercht) darin Platz. Das Schulzimmer war 32 Schuh lang und hatte je zwei Fenster nach Osten, Süden und Westen. Das Haus war aus Tuffsteinen gebaut; es hatte ein liebes Glonner Gesicht, so mitten im Ort an der Kreuzstraße mit dem winkenden weißblauen Wegweiser. In den ersten Augusttagen 1945 hat hier ein Sonntagsmaler das Idyll gezeichnet. Bei der damaligen allgemeinen Spionenfurcht, von welchen auch Lena Christ in ihrem „Unsere Bayern anno 14“ erzählt, war es kein Wunder, daß Glonner Männer den fremden Gast kräftig anfaßten und ihn zum Postexpeditor schleppten, der für den Harmlosen bürgen sollte und konnte. Zu Beginn unserer Sechzigerjahre stand das Häusl noch, es diente unsern Krankenschwestern als gern bewohnte Herberge.
Pfarrer Amann richtete, „nach gnädigst kurfürstlichem Befehl“ und seiner eigenen volkserzieherischen Leidenschaft folgend, eine Feiertagsschule ein: „Ich that es um desto eifriger und williger, weil die Moralität ziemlich locker stand.“ Jeden Sonntagnachmittag war Schule. 122 Schüler fanden sich ein, die Mädchen im Pfarrhof, die Burschen im Schulhäusl. Die Zwölf- bis Achtzehnjährigen zeigten sich nach ersten Widersprüchen der Eltern als „sehr lernbegierig“.
Den Zauber der Feiertagsschule habe ich als junger Lehrer selber noch ausgekostet. Übrigens auch einmal als Volksschüler. Das kam so. Das große Bubenspiel während des 1. Weltkriegs war das Soldatenspielen. Einmal erklärten wir den Zornedingern feierlich-schriftlich den Krieg. Die Zornedinger Buben nahmen an. Ein Sonntagnachmittag wurde vereinbart; da sollte die Schlacht in der Nähe von Pframmern ausgetragen werden. Die Vorbereitungen liefen auf Touren; die Hausaufgaben weniger. Als aber Lehrer und Kooperator sahen, daß wir nicht nur mit Kochkesseln, Brotlaiben, Erbswurst und anderen Würsten, sondern auch mit ziemlich gefährlich-montierten Waffen aller Art uns rüsteten, griffen sie auf ihre Weise zu einer Kriegslist; sie erklärten, daß sie mit uns in die Schlacht ziehen wollten, so hätten wir doch einen Marschall und einen Feldkaplan dabei. Un sere Begeisterung war so groß wie dann die Enttäuschung am ausgewählten Schlachtentag. Man sammelte uns nämlich zur mittäglichen Stunde in der Schule und dann… lasen uns Lehrer und Kooperator stundenlang Geschichten vor, um uns vor Mord und Totschlag zu bewahren. Die Zornedinger suchten vergeblich nach dem Feind.
Und jetzt zurück in die 1. Hälfte des vorigen Jahrhunderts! Als „Zierden des Dorfes“ empfanden die Glonner den 1842 erbauten Pfarrhof (es ist der heutige und nach der mustergültigen
S. 27
 Die neue Schulanlage; im Vordergrund die evangelische Kirche von 1969
Die neue Schulanlage; im Vordergrund die evangelische Kirche von 1969
Renovation unter Dekan Schneider ist das Haus wieder ein Eckstein und Zielpunkt im Ortsbild!) und das neue stattliche Schulhaus, das 1837 bis 1838 auf einem Pfarrgrund erbaut worden war. Es war die spätere Knabenschule auf dem sogenannten Apothekerbergerl. Sie wurde 1961 abgerissen. Auf ihrem Grunde wurde das Gebäude der Kreissparkasse und das Geschäftshaus M. Gürteier errichtet. Lehrer Dunkes ist voll Anerkennung für „die vielen Gemeindeglieder, die kein Opfer gescheut haben, es für alle Zeit dauerhaft zu bauen.“ Eine große Lehrerwohnung war mit eingebaut worden. Der Wirt Josef Wagner, der Furtmüller Wiesböck und der Färber Donatus Daxenberger haben in eigener Verantwortung das Haus der Länge und Breite nach größer bauen lassen als es auf dem Plane vorgesehen war. Da gab es viele Widersacher. Aber die steigenden Kinderzahlen „rechtfertigten ihr edles Vorhaben“.
S. 28
Dunkes Vorgänger war Roman Hirschböck, vorher Reitknecht in Zinneberg, und so lag es im Bilde, wenn Dunkes schreibt: „Nach dem Lehrer Böck schwang sich R. Hirschböck in den Sattel und stand der Schule 25 Jahre vor. Aber Übelgesinnte brachten ihn um den Dienst und ihn und seine Familie an den Bettelstab.“ Er wurde wegen angeblicher Überschreitung des Züchtigungsrechts entlassen. Über 20 Jahre mußten jährlich 250 Gulden aus der Armenkasse für ihn aufgebracht werden. Dunkes traf 1840 zwei Parteien in Glonn an, die einen für den vertriebenen Hirschböck, die anderen gegen ihn. Die Ersteren wollten Dunkes nicht haben, „was schon daraus erhellt, daß sie den einen Tag vor seiner Ankunft angekommenen Güterwagen nicht ableeren ließen.“ Doch Dunkes war ein redlicher Mann, der sich nach Kräften schützend vor die Ehre seines entlassenen Kollegen stellte und er war ein ausgezeichneter Lehrer, er fand die volle Anerkennung des Pfarrers Vordermayer und das Lob der kgl. Regierung. Er wirkte hier 27 Jahre. „Der Gemeindeausschuß hielt ihm im Gasthause zur Post noch eine rühmliche Letzte”.
In der langen Reihe seiner Nachfolger erwarben sich Beliebtheit oder Ansehen Thomas Grad 1904- 1911, später Schulrat in Aichach und Heinrich Reisacher 1911 – 1928; als sein Möbelwagen vorm Schulhaus stand, flog zum erstenmal ein Flugzeug über Glonn. In schweren Jahren, ab 1937, war Richard Voithenleitner der rechte Mann. Er versieht übrigens heute noch den Organistendienst. 1947 – 1952 war ich selber Lehrer und Leiter der Schule.
 Abschied der Klosterfrauen, 1972
Abschied der Klosterfrauen, 1972
S. 29
Der redliche Erich Mündel wurde später Glonns erster Rektor. Sein jetziger stets wohlgelaunter Nachfolger ist Magnus Wimmer, den uns die Egmatinger am liebsten nur geliehen hätten. In der Mädchenschule, im Haus Maria Stern, sind 1973 die Lichter erloschen. Von der Gründung des Hauses 1902 und von dem bösen und dummen Gewaltakt 1937 (1945 durften die Sternschwestern erst wieder in die Schule) ist an anderen Stellen dieser Schrift zu lesen. Zuletzt mußte das Mutterhaus in Augsburg wegen mangelnden pädagogischen Nachwuchses die Glonner Niederlassung aufgeben. Nur ungern hat man die Schwestern ziehen lassen und wie einst dem Lehrer Dunkes bereitete auch ihnen die Gemeinde in einer schönen Dankfeier „ein rühmliches Letzt“. Unvergessen bleiben besonders die Oberinnen Elekta Schilling (1902 — 1936) und Bernardine Ausberger (1910 — 1969). Das liebe Schwäbisch der Sternschwestern ist nicht mehr zu hören. Das Sternhaus war doch für so manche Glonnerin in schweren Stunden „a guats Anloihnale“.
1956/57 wurde ein neues Schulhaus auf dem gemeindlichen Sportplatz erbaut; zugleich wurden von Josef Winhart zwei Tagwerk Grund zusätzlich eingetauscht. Am 8. Dezember 1957 wurde das Haus unter der mildlässigen Herrschaft von Bürgermeister Eichmeier vollendet und eingeweiht. Das waren damals Jahre eines wohltuenden Zusammenhalts aller und erst ein solcher gibt Heimat auf dem Heimatboden ab. Und als 1969 —1971 das Haus unter dem energisch-zielbewußten Bürgermeister Decker zum Schulzentrum erweitert werden mußte und als dies in einer großartigen Weise geschah, da geschah dies nicht um eines bloßen Fortschrittes willen, denn ein solcher kann ja auch von der Mitte des Lebens wegführen, es geschah, damit das Gute in der Heimat immer stärker bleibe als alles Ungute. Eine Turnhalle und ein Hallenschwimmbad wurden mitgebaut und so dem ganzen Umland eine sportliche Mitte geschaffen. Die Gesamtkosten betrugen 1957 540.000 DM, 1971 aber 2.470.000 DM.
Der Weihetag im Dezember 1971 hatte auch den Neffen des Bürgermeisters Decker herangelockt, den Staatssekretär mit dem uns von Moosach her lange schon vertrauten Namen Sackmann. Dabei zeigte die Schule überzeugend ihr musisches Leistungsvermögen.
S. 30
Der Kindergarten, „dös kloane Brüadal da Schui“, wurde 1930 im Mädchenschulhaus eingerichtet; 1950 gab man ihm Raum im Pfarrerstadel; von 1965 bis 67 baute sich die Pfarrei unter Pfarrer Loithaler mit einem Aufwand gegen 900 000 Mark sein Pfarrzentrum mit Pfarrsaal, Kindergarten und Jugendheim. Schwester Edelinde hat den Kindergarten mit großer Liebe zu den Kindern und mit Zuneigung zu Glonn, so wie es ist, durch viele Jahre betreut.
S. 31
„Ein Lagebericht” — Glonn zwischen 1800 und 1868
Zwölf Millionen Wähler hatten 1848 die Abgeordneten für die erste deutsche Nationalversammlung gewählt. 330 davon zogen am 18. Mai unterm Geläute der Glocken und entblößten Hauptes in die Frankfurter Paulskirche ein. 275 folgten noch im Laufe der nächsten Wochen. Unter den Delegierten war auch der Glonner Lehrer Johann B. Dunkes. Er hinterließ uns einen Lagebericht über das Glonner Land und Leben zwischen 1840 und 1868. Dunkes war gebürtiger Freisinger. Nach einer guten Ausbildung wird er Lehrer in jenem stolzen Berchtesgaden, das Ansprüche stellte und dessen gefürstete Propstei an die tausend Jahre keinen anderen Herrn über sich geduldet hatte. Dunkes wird befördert und bekommt die Glonner Schulstelle. Der Distriktsschulinspektor qualifiziert ihn hier in allen Fächern mit der Note hervorragend. Dunkes Aufzeichnungen über Glonn gehen nach ihrer stilistischen und menschlichen Qualität weit über das hinaus, was man sonst aus jener Zeit in Schulen und Gemeinden aufzufinden pflegt. So sei vorgeschlagen, von den zwölfhundert Jahren Glonns runde 30 Jahre einmal genauer mitzuerleben.
Die Entfernungen mißt Dunkes nach Stunden. Das ist ganz natürlich. Professor Lebsche, der Doktorssohn von Glonn, erinnerte sich später genau, um welchen Frühmorgenglockenschlag man bei der Zinneberger Kapelle sein mußte, um per pedes in Grafing den ersten Zug nach München noch zu erreichen. Für Dunkes lag Glonn 8 Stunden vor München, 4 Stunden vor Aibling und 5 ½ Stunden vom Markte Schwaben entfernt. Die Ausdehnung der Gemeinde maß von Doblberg bis hinter den Wirt von Frauenreuth 1 ½ Stunden, 1 Stunde vom Pframmerer Holz bis zur Huberkapelle an der Berg- angerer Straße (die Kapelle ist abgerissen, ihre große Kreuzigungsgruppe in der Glonner Aussegnungshalle). Die Gemeinde Glonn zählte 214 Häuser, 54 davon standen im Dorf. Im Sitzungssaal des Rathauses kannst Du letztere auf 2 erhaltenen Bildern des Malers Magnus Meßner einmal nachzählen.
Dunkes liebte die Landschaft, das Glonner Panorama von den Zinneberger Schloßlinden und die Sicht von Spitzentränk (heute die Schießstätte) auf die Bayerischen und Tiroler Berge — „vom Säuling bis zum Gaisberg eine Strecke von 50 und mehr Stunden“. Die Berge „entzünden bei heiterem Himmel jedes Menschen Aug, welches Gefühl für Naturschönheit und Empfänglichkeit für Gottes große Schöpfung im Herzen trägt.“ Der Chronist von damals hatte auch Gefühl für die Anmut unseres Hügellandes, das sich so vorteilhaft von den „einförmigen und ermüdenden Gegenden von Westen und Norden“ abhebt und das sich „mit seinen Anhöhen und lachenden Tälern . . . am Alpenrande . . . auszuruhen pflegt.“
Der Kupferbach hieß noch „die Lauß“. Es gab in Glonn u. a. 3 Krämer, 3 Schneider, 1 Lederer, 1 Färber „mit Hucklerei“, 1 Sattler, 1 Boten, der zugleich Stellwagenführer war, 7 Müller, 1 Waffen- und Hufschmied, 1 Mühlarzt. Für die Gesundheit sorgten ein praktischer Arzt und 1 Chirurg (= Wundarzt) und 1 Hebamme. „Selbst die Kunst ist hier vertreten durch einen Maler,
S. 32
Vergolder und Anstreicher“. Die übrigen sind Taglöhner und nur einer ist ein bedeutender Ökonom. Die Entstehung der 5 Branntweinschenken (ihr Geist wurde aus Korn, Obst und Kartoffeln erzeugt!) führt Dunkes auf das Johannifest zurück, bei welchem mit Teufeln und Engeln ein großes geistliches Spektakulum unter ungeheuerem Zulauf von nah und fern aufgeführt wurde. Vielleicht haben die Glonner ihre bekannte einfallsreiche Lust an hintersinnigen Hochzeitsscherzen und an närrischen Umzügen von damals her noch im Blut. Auf die Schenken ist Dunkes schlecht zu sprechen, „hat sich dort doch mancher schon nebst einem stinkenden Athem ein zitterndes Siechtum, ja sogar den Säuferwahn geholt“.
Die bedeutendste Erwerbsquelle waren die Tuffsteinbrüche. Was im Sommer aus den Tiefen geschlagen wurde, führten den Winter über die umliegenden Bewohner „auf Schlitten zu mehreren hundert Klaftern“ fort: „Die großartigsten Gebäude prangen und verkünden durch Wohlstand die Segnungen eines fast fünfzigjährigen Friedens.“
Dunkes weiß auch noch von den berühmten Glonner Fahnen, wie sie von 1803 bei der Wallfahrt der Glonn im Münchner Dom getragen wurden, „70 Fuß lang, die sich oben dünn auslaufend wie Geiseln schwingen“. — Bei der Mission von 1845 war der Andrang so groß, daß die Kirche nur zwischen 10 Uhr abends und 1 Uhr nachts geschlossen werden konnte. „Feindschaften hoben sich auf, Gestohlenes wurde restituiert. Aber wie lange dauert dieß?“
S.33
Die reiche Ausstattung der Kirche in Kreuz wird hervorgehoben. Die Adlinger werden wiederholt gelobt. Sie haben das Kirchlein „zur Nothdurft der Gläubigen“ käuflich an sich gebracht, und sie erhalten es „in erbaulichster Reinlichkeit“. Übrigens auch heute noch; eben haben die Adlinger wieder ihren reizenden be- kuppelten Turm in gemeinsamer Anstrengung restauriert. Der Adlinger Schmied und Windenmacher Obermayer war berühmt in seinem Fache. „Seine verfertigten Winden werden nah und fern gesucht und auch die kgl. Baubehörden machen Bestellungen.“ Die Adlinger und Doblberger waren auch gute Jagdschützen und zeichneten sich wiederholt beim Oktoberfestschießen aus.
1847 werden „zwei Fräuleins des Grafen Arko Zinnenberg“ durch den Erzbischof in der Schloßkapelle gefirmt und die übrigen Firmlinge in der Kirche zu Glonn. Von den vielen Kapellen, „je nach Kraft und Geschmack gebaut“ erwähnt Dunkes die „Kolomanskapelle“ bei Haslach mit ihrer reinen reichen Brunnenquelle, ferner die vom Anderl von Westerndorf vergrößerte Waldrandkapelle (sie ähnelt der „Waldkapelle“ wie sie der Romantiker Schwind später malte), dann die Kapelle beim Weigl in Ursprung und schließlich jene an der Bergstraße zum Zinneberger Schloß „mit ihrer sehr gut geschnitzten Christusfigur“. Vor etlichen Jahren wurde diese gestohlen und sie tauchte bis heute nie mehr wieder auf.
Dunkes läßt die Glonn nur aus sieben Quellen entspringen. Hat er nur die stärkeren gezählt oder haben uns damals auch schon die Münchener das Wasser entwendet? Er sieht die vielen Forellen und Aschen, „die aber nur Leckerbissen für die Tafel der Vornehmen werden“ (hier hat sich der brave Lehrer Dunkes sicher ein wenig getäuscht) „und die Minderbemittelten nur das Vergnügen haben, diese munteren Wasserbewohner in ihrer Unerreichbarkeit spielen zu sehen“. Der Kastensee wurde „seit 20 Jahren zunehmend kleiner und die Karpfen und Hechte waren „wegen des starken Moosgewächses und wegen des filzartigen Grundes“ schlecht zu fangen.
S. 34
Drei Kriege und 46 Jahre Frieden — 1868 bis 1918
Fünf Glonner waren es, die den Krieg von 1866 mitmachen mußten. Weder beim Auszug noch bei der Rückkehr nach der Niederlage sahen die bayerischen Soldaten ihren König. Vom Zwiespalt zwischen der Liebe zu dem schönen träumerischen Ludwig und dem Befremden über seine zunehmende Entfernung vom Volk war auch das so königstreue Volk im Oberland betrübt. Daß die Preußen das große Österreich besiegt hatten (und daß sie einige Jahre darnach gar noch den Kaiser der Franzosen fingen) machte auch in Glonn Eindruck. Die rechtsgesinnten Liberalen schwärmten vom Anschluß an den Norddeutschen Bund. Gemeinden im Chiemgau aber richteten schon 1867 an Ludwig eine leidenschaftliche Bitte, Bayern souverän zu erhalten. Man wählte konservativ, kirchlich und patriotisch. Die „Patriotenpartei“, ab 1887 nannte sie sich „Zentrum“, war die absolut größte Partei des Landes und die in Glonn fast allein gewählte.
1870 gab es im Landtag leidenschaftliche Reden gegen den Krieg und für eine bewaffnete Neutralität. Aber der Zorn gegen „die Welschen“ war erwacht und bald ließen die Siege von Weißenburg und Sedan die Niederlagen von 1866 vergessen. Im Münchner Ostbahnhofviertel erinnern zahlreiche Straßennamen an die Orte der damaligen Siege. Und bei der Belagerung von Paris sangen sich die bayerischen Soldaten ihr strophenreiches „Siebzgerlied“ zusammen: „ . . . und die schwarzen Turkos, / wos de Wuidn san, / dö müassn uns gschicha hobm, / weil s‘ glafa san“. Der Krieg wurde gewonnen. Aber bei der Kaiserproklamation in Versailles wurden die Altbaiern nicht sehr warm; ein bayerischer Prinz schrieb an Ludwig: „Mein Herz wollte mir zerspringen, alles so kalt, so glänzend, so prunkend und herzlos und leer.“ Und der Dr. Sigl schrieb im „Bayerischen Vaterland“, nun werde es bald „mehr Kriege, mehr Krüppel, mehr Totenlisten und mehr Steuerzettel geben.“ Das später errichtete Bismarckdenkmal überm Starnberger See hat nie die Sympathien der Glonner gefunden. Aber am Schloßeingang zu Zinneberg pflanzte man 1871 in Freude und Hoffnung die Friedenseiche, die inzwischen zwei Weltkriege überlebt hat und immer noch grünt. Vom Zündnadelgewehr aber meinte man, daß es der Teufel für die Preußen erfunden habe, weil sie schneller schießen konnten als sonst ein redlicher Schütz, der noch auf den Knien mit dem Ladstock laden mußte.
Ludwig II. fühlte sich durch das Kaisertum in seiner Macht und Würde empfindlich getroffen und versank immer mehr in seinen einsamen Träumen. Neuschwanstein entstand und nach 1874 verschlang der Schloßbau auf der Herreninsel Millionen. Dennoch: Der Tod Ludwigs am Pfingstsonntag 1886 fiel noch ins letzte Häusl unseres Tales wie ein schwerer Schatten. Noch 40 Jahre später hörte man zum Zitherklang die gefühlvolle Melodie des Neuschwansteinliedes: „Auf den Bergen wohnt die Freiheit, / auf den Bergen ist es schön, / wo des Königs Ludwigs II. / alle seine Schlösser stehn.“ Des Sonntags aber sangen in unsern Wirtshäusern rauhe Männerstimmen die Ballade „Zu Sedan wohl auf den Höhen . . .“ Die Veteranentage wurden sehr festlich gefeiert.
S. 35
 Glonn 1886 – gemalt von Peter Meßner
Glonn 1886 – gemalt von Peter Meßner
Ein bekannter Festredner, selbst Kriegsveteran, begann seine Ansprache stets mit den Worten: „Ruhmreiche Veteranen, sieggekrönte Krieger . . wobei ihn freilich alsbald die Rührung übermannte. Noch 1914 fragten wir Buben die alten Veteranen, wie es denn mit dem neuen Krieg weiterzugehen habe.
S. 36
1875 zählte man das Volk; unsere Gemeinde — damals eine der größten im Bezirksamt — wies 1360 Katholiken und 7 Protestanten auf. 1880 feierte man das 700jährige Jubiläum des Wittelsbacher Fürstenhauses. Die Schulkinder wurden nach Zinneberg geführt und dann im Glonner Gasthaus „mit Bier, Brod und Würsten reguliert. Die Kinder deklamierten und hielten komische Vorträge.“
Im Zuhaus zum Neuwirt war nach dem Jahre 1878 die Gendarmerie untergebracht; der dortige Arrest diente meist nur zur vorübergehenden Unterbringung harmloser „Handwerksburschen“ oder aufsässiger Zigeuner. 1890 besetzte eine ganze Karawane Fahrender mit über 20 Wägen den Marktplatz. Polizei und Feuerwehr mußte sie vertreiben. Später halfen bei solch gefährlichen Aktionen die Glonner Metzgerburschen mit ihren Ochsenfieseln mit.
Unter Prinzregent Luitpold, dem Fürsten im Volk ohne Falsch und in der Lederhose, gab es eine glückliche Zeit. Das Postwesen wurde verbessert, die Eisenbahnen mehrten sich rasch, für die Schulen wurde mehr getan und die Kunst gefördert. In Berbling malte Leibi drei Jahre hindurch an seinen drei Beterinnen, ein Bild, das in guten Drucken heute in so mancher unserer Bauernstuben hängt. Karl Haider, dessen Vater Forstgehilfe in Anzing gewesen war, malte unsere Voralpenlandschaft so ernst und innig wie keiner vor ihm. Eines seiner Bilder könnte bei Höhenrain oder über der Mang- fallschlucht bei Grub entstanden sein. Die alten Baustile freilich zog man damals noch wie Theatergewänder an; man baute neuromanisch, neugotisch, neubarock. Auch in Glonn entstanden einzelne Häuser, die weiß Gott woher gekommen waren. Aber die alten Hausnamen waren noch in aller Mund: Der Limbeck, der Färber, der Furtmüller, der Schuasterpauli, der Zehenthof, der Nogeschmied und der Hans- schuaster, in dessem schmucken Häusl 1881 die Dichterin Lena Christ geboren wurde.
Mit Gelassenheit und grundehrlich wurde die Gemeinde von ihren Bürgermeistern geführt, vom Niedermaier von Hecken, vom Christl- müller Beham, von Sebastian Türk. Ihnen folgten nach der Jahrhundertwende der repräsentative Gastwirt Lanzenberger, der überaus gebildete und belesene Joh. Kiermaier als Kriegsbürgermeister, dann der leutselige Schlosser Meßner und, nehmen wir alle weiteren gleich dazu!, der feinsinnige, lautere und ausgezeichnet redende Neuwirt Ludwig Mayer; von 1933 bis 1945 der sich politisch zurückhaltende Kunstmaler Georg Lanzenberger, den mit allem Eifer Pankraz Mennacher 1945 ablöste, bis dann Johann Eichmeier von 1946 bis 1960 und Anton Decker von 1960 bis 1972 jeweils mit überzeugender Wählerzustimmung das Heft in der Hand hielten. Vom Vertrauen seiner Gemeinde gerufen, sucht nun Michael Singer auf seine Weise seinen Vorbildern gerecht zu werden.
S. 37
 Johann Eichmeier, Bürgermeister von 1946-1960
Johann Eichmeier, Bürgermeister von 1946-1960

Anton Decker, Bürgermeister von 1960-1972 (Foto Hintermaier)
In den Achtziger- und Neunzigerjahren wirbelte das Haberfeldtreiben die Ordnung des Landes auf. 1895/96 wurden auch bei uns zahlreiche Haberer verhaftet. Der letzte Haberermeister war hier der junge Brandlhausl von Münster. Nach langen Gefängnisjahren ist er Junggeselle geblieben, 1925 erschlug ihn ein Holzscheit, das von der Kreissäge absprang.
Die Glonner Kinder spielten die fantasiebetonten Spiele: „Räuber und Schandi“, „Schneida, Schneida, leih ma d’Schar“ und das urwüchsige „Sautreibn“ mit den orffschönen*) Versen „Samstarasuppn, Samstarakraut, daß si a jeda um a Loch umschaut“. Die Buben badeten im Kupferbach, die Dirndl in der Glonn oder im Kastensee. Niemand wollte ein „Buama- oder Dirndlpoister“ sein!
*) das heißt so schön wie von Orff.
S. 38
Unter der Musikerdynastie der Diemer und Faßrainer gab es eine ausgezeichnete weitum gesuchte Glonner Musikkapelle und zum schönsten Ohrenschmaus meiner Kindheit gehörten die mittäglichen Musikproben, die das kleine Schuasterhäusl erschütterten. Aber auch die rasanten Kehrausverse verachtete ich nicht: „ös Lumpn, ös Spitzbuam, ös Hoberfeldtreiber, ös Sautreiber, ös Schnointreiber, ös Haberl von Marschall (Name einer berühmten Räuberbande in der Holzkirchner Gegend), ös Bazin gehts hoam!“ Ein Altbaier fühlt sich bei einem solch anschaulichen bildkräftigen Beschimpftwerden ganz wohl und er sagt sich: ein bißl a Lump und bißl a Spitzbua steckt in jedem von uns!
Von England ist in der Mitte des Jahrhunderts ein neues Wunder mit Feuer und Dampf gekommen, die Eisenbahn. Ärzte und Professoren haben zuerst die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Aber das Posthorn verstummte, die Straßen wurden leer. Auch Glonn forderte seine Bahn. 16 Mühlen, 17 Sägewerke und die Tuffsteinbrüche mußten für eine Begründung herhalten. Den Ausschlag aber gaben die Nonnenplage und der Landtagsabgeordnete Posthalter Wolfgang Wagner mit seinen Beziehungen zu mächtigen Männern im Parlament, zu Dr. Orterer und Dr. Daller. In 10 Monaten war man mit dem Bau fertig. Der Tag der Eröffnung, der 26. Mai 1894, war ein Festtag erster Ordnung. Die Gemeinde hatte tausend Goldmark für die Dekoration zur Verfügung gestellt. Die Böller krachten, als hätte man zehn Fronleichnamstage auf einmal zu feiern gehabt. Die erträumte Fortsetzung der Bahn nach Westerham oder Aibling wurde freilich nie Wirklichkeit. Die alte dickbäuchige Lokomotive (als Kinder hießen wir sie „die Kaffeemui“), „dieser Kapotthut unter Dampf vor den drei, vier kurzen Waggons aus der Jahrhundertwende“ (so Helmut von Cube) kam 1954 zum Jubilieren noch einmal nach Glonn. Am 1. Mai 1970 wurde die Bahn eingestellt und lustige Landsleute brachten es fertig, aus der „Trauerfeier“ eine ergötzliche Galgengaudi zu machen.
Und jetzt noch eine wahre Bahngeschichte: Der Jakl, ein lieber alter Loder, ging mit seiner Frau zu Fuß nach Grafing. Aber der zur Heimfahrt ausgedachte Zug war schon fort. Da sagte der Jakl: „Weibi, iatz woaß i gwiß, daß d‘ schiach bist; iatz host ma an Zug aa no vasprengt.“ Aber das „Weibi“ gab ihm so raus, daß der Karl Valentin „Respekt!“ zu ihr gesagt hätte: „Jakl, reg di net auf! Lang ko er no net furt sei; d’Gleis san no do“! Der Jakl hatte dann doch das letzte Wort: „Aber dös muaßt zuagebn, Weibi, wenn ma iatz net so grennt waarn, brauchatn mia iatz net so lang wartn“.
Das erste Auto, welches durch Glonn fuhr, steuerte ein Bediensteter des Barons Büssing von Schloß Zinneberg, mit dem zweiten ließ sich der Doktor zu den Patienten fahren.
Ärzte gab es hier schon früher. So hat man 1878 dem Chirurgen Karl Hackl für 42 Jahre treue Dienste in Glonn „ein Anerkennungsdiplom in künstlerischer Ausstattung (Wert 120 Mark), ein Bierglas und silberne Löffel“ überreicht.
S. 39
Von 1885 bis 1935 wirkte als Arzt und einflußreicher tätiger Bürger Dr. Max Leb- sche. Er wurde Ehrenbürger, sein Sohn Max und seine Tochter Klara kamen später zur gleichen Würde. Einen Glonner Musikanten hat der Dr. Lebsche einmal gewarnt: „Du wirst nicht 35 Jahre alt!, du hast schon eine Sudpfanne Bier zu viel getrunken.“ Die Feststellung mochte stimmen, aber die Prognose war falsch, der Berti ist über 90 Jahre alt geworden und hat bei seiner eigenen goldenen Hochzeit noch die Posaune geblasen. — Lange Zeit wirkten als Ärzte hier Dr. Kreutzer sen., Dr. Haerlein und Dr. Jäger. Heute ordinieren Dr. Kreutzer jun., Dr. Hüller und Dr. Ries. Seit 1936 arbeitet Dr. Ellmann als Zahnarzt. Später kam noch der Zahnarzt Volkheimer hierher. Eine Apotheke existiert seit 1868, die gegenwärtige Inhaberin ist Frau Elisabeth Romacker.
Der Postdienst wurde 1883 von der alten Posthalterei abgetrennt. 1885 kam der Telegraph (man redet heute bei den Lichtmasten noch von „Telegraphenstangen“.) Wir staunten, wie da auf langen schmalen Papierschlangen die Morsezeichen sich einritzten. Dabei passierte Expeditor Sossau im Krieg ein Übertragungsfehler, den ihm die damals siegbewußten und vaterländisch gesinnten Glonner recht verübelten. Sossau hatte übersetzt: „Durch einen feindlichen Flieger wurde in Friedrichshafen eine Fülle von Zeppelins zerstört“; dabei hätte es „die Hülle eines Zeppelins“ heißen sollen. 1927 wurde gegenüber dem Bahnhof ein Postgebäude errichtet.
 Der Steinfink Berti von Adling – Porträt von Elisabeth Hüller
Der Steinfink Berti von Adling – Porträt von Elisabeth Hüller
S. 40
Ab 1899 erzeugte der Furtmüller Peter Kastl Strom durch Wasserkraft. In der „Lanz“ wurde das Licht zuerst erprobt. Das Glonner E-Werk ist heute noch im Besitz der Familie Kastl- Altinger.
„Grünes Licht“ gab es für Glonn am 24. September 1901; es traf folgendes Telegramm ein: „Die Erhebung des Pfarrdorfes Glonn zum Markte wurde Allerhöchst genehmigt. — Staatsminister des Innern, Feilitzsch“. Das Telegramm hat hier keinen übermäßigen Jubel hervorgelockt.
11 Jahre vorher aber hatte die Entlassung Bismarcks durch Wilhelm II. Sorgen gemacht. „Der junge Herr“ gab Rätsel auf. Der Dreibund Deutschland, Österreich und Italien (dieses hatte man dazugenommen, daß im Kriegsfall Österreich nicht auch im Süden bedroht wäre, was dann 1915 doch der Fall war!) umspannte den Raum des alten Römischen Reiches deutscher Nation; aber es gab 2 Kaiser, nicht einen und Österreich schleppte seine Fremdvölker mit.
In Bayern traten 2 neue Parteien auf, die Sozialdemokraten und der Bauernbund, der aus Protest gegen das dauernde Absinken der Fleisch- und Getreidepreise entstanden war. Der zugkräftige und kämpferische Bauernbünd- ler Eisenberger hat auch in Glonn gesprochen. Die Sozialdemokraten hatten in Georg von Vollmar einen nicht doktrinären und bayerisch gesinnten Führer, nach dessen Beobachtungen es bei uns keine so großen Klassengegensätze gibt „sondern Verkehr auf gleichem Fuß, keine Scheu von Unterwürfigkeit, aber Genußfreudigkeit und mäßige Arbeitslust“. 1894 sagte er: „Es kann nicht jeder ein Preuße sein!“ Ab 1893 fand der Christliche Bauernverein in unserem Tal eine überzeugte Anhängerschaft. Sein Führer war Dr. Heim. Seine Abneigung gegen alle Leisetreterei verschafften ihm noch in den Dreißigerjahren bei uns große Sympathien. 1932 zog er in Tuntenhausen gegen Hitler und dessen Anhänger mächtig vom Leder: „Maultrommler sans!“ Ludwig Thoma schickte ihm 1915 eines der ersten Exemplare seiner „Heiligen Nacht“.
Am 12. 12. 1912 war Prinzregent Luitpold gestorben. Als König Ludwig der III. folgte ihm sein Sohn in der Regentschaft. Das war ein König des Friedens und nicht des Krieges, ein König der Mustergüter und nicht der politischen Manipulationen. In München nannte man ihn, erst scherzend und in den Bitternissen des Krieges auch spöttisch, den „Milibauern“. Wir Kinder aber meinten es ernst, wenn wir an Festtagen in der Schule sangen: „Heil unserm König, Heil . . . erhalt ihn Gott!“ Er war ein frommer Mann. Sein Land bekam unter ihm das Fest der „Patrona Bavariae“ und in München saß nach 125 Jahren erstmals wieder ein Kardinal; es war der Erzbischof Bettinger, der fast Jahr für Jahr nach Ebersberg zur Firmung kam.
Bayern wollte Frieden und keinen Krieg, aber der König klagte: „Der Kaiser läßt keinen zu Wort kommen!“ So war es auch später einmal mit dem „Führer“; ein Glonner hat es am eigenen Leibe erfahren und er hat es niedergeschrieben. 1914 fielen die Schüsse in Serbien.
S. 41
Am 1. August morgens hingen auch in Glonn die roten Plakate der Mobilmachung. Eine Welle der Begeisterung ging auch durch unser Land, sehr im Gegensatz zu 1939. Unter der weißblauen Veteranenfahne wurde im Neuwirtsgarten fröhlicher Abschied gefeiert. Lena Christ schilderte ihn auf ihre Weise in der „Rumplhanni“ und bald erschien auch ihr Erfolgsbuch „Unsere Bayern anno 14“. Es gab auch so besinnlich Gelassene unter uns, wie einen Bauern, der auf seinem Felde arbeitete und sagte: „Solang mi da Burgomoasta net hoit, werd g’maaht!“
S. 42
In der Schlacht von Lothringen war die Bayerische Armee noch geschlossen unter Kronprinz Rupprecht im Feld. Im Frühjahr 1915 zog ein bayer. Korps unter General Bothmer in die Karpaten. Eine Bothmerstochter war Schloßherrin auf Zinneberg und betreute das dort im ehemaligen Bräuhaus eingerichtete Lazarett, das noch vielen Glonnern willkommene Heimstätte nach Verwundungen werden sollte. Ab 1915 kämpften und fielen junge Glonner Landsleute auf den Bergen Südtirols.
Aber dann welkten die Siege, der Wohlstand sank dahin, Teuerung und Hunger brachen aus. Die Heimat aber lebte noch. Thoma schrieb seine unsterbliche baierische Weihnachtslegende, Richard Strauß seine Alpensinfonie.
1918 brach die Revolution aus. Sie begann auf der Theresienwiese in München. Ein Unteroffizier besetzte den Landtag. Ludwig III. ging nach Wildenwart und dann auf sein ungarisches Gut. 1921 kehrte er tot zurück.
S. 43
S. 44
Die Heimat behauptet sich – 1918 bis 1945
In Glonn gab es keine Revolution, Ordnung und Leben hielten sich im Gleichgewicht. Aber in München gab es den Kurt Eisner. Nach Hubensteiner war er „ein glänzender Journalist, aber eitel und voll verstiegenem Idealismus; er besaß kaum etwas, was ihn dem bayerischen Wesen hätte näherbringen können.“ Die erste freie Landtagswahl trug seiner Partei nur 3 Mandate ein. Der blutjunge Graf Toni Arco- Valley erschoß ihn aus eigenem Entschluß. Arco saß lange in Landsberg gefangen. Nach 1933 kam er zeitweise ins KZ … Er hatte Äußerungen getan, daß es auch noch eine weitere Kugel bei ihm gebe, um Deutschland von dem Diktator zu befreien. Am 7. April 1919 wurde die Räterepublik ausgerufen. Der Widerstand auf dem Lande wuchs, auch bei uns in Glonn. Kinder des Grafen Arco-Zinneberg von Maxlrain mußten heimlich nach Glonn gebracht werden, um vor Racheakten geschützt zu sein. Die Familie Sanitätsrat Lebsche nahm sie auf. Glonn lag ungünstig. München, Kolbermoor und Rosenheim war in der Hand der „Spartakisten“. Ihre Bewaffneten kamen nach Glonn und in die Dörfer, um zu requirieren. Das Freikorps Grafing wurde gegründet. Bei der Einberufung der Glonner war der Schmied Wäslerhans mit Trachtenhut und Lederwams, mit Pistole und Karabiner der erste am Bahnhof. Max Sarreiter von Mattenhofen und Leutnant Wiedemann von Niederseeon verloren in den Kämpfen ihr Leben. General Bothmer entkam dem Geiselmord im Luitpoldgymnasium. Am 3. Mai ergab sich Kolbermoor dem Grafinger Korps.
Aus der Einwohnerwehr ging der Isengau hervor, der auf der Schießstätte seine Mitte fand. Ludwig Thoma polterte im „Miesbacher Anzeiger“, der auch bei uns damals viel gelesen wurde. Bei der Landtagswahl 1924 erhielten in Glonn die Bayerische Volkspartei 323 Stimmen, der Völkische Block 140, der Bauernbund 171, die Sozialdemokraten 26 Stimmen.
Am 10. 12. 1923 war der Geldentwertung ein Ende gesetzt worden; für 1 Billion erhielt man 1neue Rentenmark. 1924 kostete 1 Semmel 2Pf. Die Sommerfrischler kamen wieder. Geistl. Rat Winhart, Pfarrer Schrall und Altbürgermeister Kiermeier wurden Ehrenbürger.
Bei der Einweihung des Kriegerdenkmals hatte ein Festzeichen 10 000 M gekostet Das Denkmal hatte weit über 5 Milliarden verschlungen. Den Fehlbetrag von über 1 Milliarde deckte einer der aufrechtesten Männer jener Zeit, der Weiglbauer Ludwig Winhart.
1920 hatte die Gemeinde den alten Zehenthof am Marktplatz erworben, in welchem früher das Zehentgetreide für den Pfarrer gelagert wurde. 1931 wurde nach dem Abbruch das neue Rathaus erbaut: „Gemeinsinn und Bürgerfleiß schaffen auch in Zeiten, die so schwer sind, Großes für die Gegenwart“. Glonn erhielt sein schönes Wappen (Entwurf v. Prof. Hupp), „in Silber ein schwarzes Mühlrad, überhöht von einer linkshin schwimmenden natürlichen Forelle.“ Prof. Lebsche war Initiator und Geldgeber zugleich. 1931 gab es 5 Millionen Arbeitslose, 70 in Glonn. Am Rathausplan hat ein Sohn von Oskar von Miller (Schöpfer des Deutschen Museums) mitgearbeitet.
S. 45
Der grundgediegene damalige Bezirksamtmann Wissel hatte das Bauvorhaben wesentlich unterstützt. Kosten: 90 000 RM. Hinter dem Rathaus breitet sich das weite Feld der Toten aus. Dazu sagte Prof. Lebsche 1931: „Der wohlgepflegte Friedhof ist ein beredtes Zeugnis für die Glonner Heimattreue“.
In Glonn gab es eine Gruppe des „Bayerischen Heimat- und Königsbundes“. Die Monarchie ist manchmal „vor der Tür gestanden, aber hereingekommen ist sie nicht“. Bei der Reichspräsidentenwahl am 24. 2. 1932 stimmten in der Gemeinde 810 Bürger für Hindenburg, 63 für Hitler, 2 für den Kommunisten Thälmann. Der Bürgermeister schrieb ins Buch: „Möge Gott dem 85-jährigen Feldmarschall eine ruhige Amtsperiode geben!“ — Vor 1933 waren hier nur ganz vereinzelte Parteigänger Hitlers. Im November 1932 gab es für die NSDAP nur 65 Stimmen. Selbst nach der Machtübernahme im März 1933 brachte es „die Partei“ nur auf 230 Stimmen (VP. 363, Bauernbund 193, SPD 35 Stimmen) – Im April 33 wurden der VP. 5 Gemeinderäte, der NSDAP 3, dem Bauernbund 2 zugesprochen. Aber im September bestimmte die Kreisleitung einen neuen astreinen Gemeinderat und der Neuwirt trat konsequent als Bürgermeister zurück.
In der Nacht zum Pfingstsonntag 1937 wurde dem schwierig gewordenen Hauptiehrer Höllweger von den Brüdern Martin und Alban Huber unter Mithilfe ihrer Schwestern ein mit NS- Kennzeichen versehener Pfingstlümmel aufs Dach gesetzt. Gleichzeitig wurden Protestplakate gegen den Abbau der klösterlichen Lehrerinnen angeschlagen. Tagelang hielt sich die Gestapo in Glonn auf. Bei den Vernehmungen hielten sich besonders die Glonner Frauen tapfer und gerade. Die Brüder Huber und vorübergehend der nicht beteiligte Pankraz Men- nacher kamen in Haft. Glonngetreue Helfer brachten die Brüder Huber nach 6 Wochen frei und erwirkten die Versetzung des Lehrers. 1933 hatten sogar die Gemeinderäte der NSDAP einem Versetzungsantrag gegen Höll- weger zugestimmt.
S. 46
Die Predigten Kardinal Faulhabers und das päpstliche Rundschreiben „In brennender Sorge . . .“ wurden hier von Haus zu Haus weitergereicht. Einmal klopfte auch P. Rupert Mayer mit seiner Beinprothese die Stufen der Glonner Kanzel hinauf, seine Meinung zu sagen.
1937 ließ Gauleiter Wagner die klösterlichen Lehrerinnen abbauen. Auf Grund einer Klausel in der Stiftungsurkunde verschenkte er damit das Mädchenschulhaus mitsamt seinem schönen Garten den Herren vom Münchner Domkapitel; da sage noch einer, Wagner hätte einen antiklerikalen Affekt gehabt. (Erst in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde den Besitz durch Kauf zurückerworben.) 1939 begann man für einen Schulhausbau in Gemeinschaftsarbeit den Kanal zu graben. Aber der Schmied-Wäslerhans kam vorbei und sagte: „Schütts den Grobn wieder zua, iatz kimmt a Kriag, den valiern ma und dös Schuihaus werd nia mehr wieder baut!“ Nur mit dem letzteren Teil seiner Voraussage hat der Hans nicht rechtbekommen.
Der unselige Krieg kam. „Der Mensch kann mit der Macht die zerstörendsten, die törrichtsten und die bösesten Dinge tun. Aber der Mißbrauch der Macht schädigt am meisten den, der die Macht mißbraucht.“ (Guardini)
Das gewaltige Unwetter vom Juli 1936, das von Starnberg bis Rott am Inn die Gegend verwüstete, war wie eine Menetekel für das, was nach 1939 über die Welt kommen sollte.
Den Humor haben die Glonner auch in schweren Tagen nie ganz verloren. Als nach dem Unwetter von 37 der Pitzer Lenz mit seiner Glasschwinge über die verwüstete Straße lief, stand gerade der Huberwirtsdori unter der Tür. Er rief dem Lenz zu: „So, Gloser, host da aa amoi a guate Arnt dabet’t!“ — Als mein Bruder, der General, bei einem Blitzbesuch in Glonn den Decker Toni beim Neuwirt mit einem mächtigen Bart sitzen sah, bemerkte der Wiesmüller Lenz: „Woaßt, Karl, den hot er si wachsn lassn, daß er in Linz drunt besser brinnt“. (Bei Linz wurden geistig Krapke als „unwertes Leben“ heimlich gemordet!).
Die schönste Frontzeitung, die es in Glonn gab, war die Neuwirtssali. Wer eine Feldpostnummer verloren hatte, bei ihr bekam er sie wieder; wer etwas Neues von einem Soldaten draußen wissen wollte, bei ihr erfuhr er es. — Ein Ehrenblatt für Glonn bedeutet es, daß die feindlichen Gefangenen sich hier als Menschenbrüder fühlen durften. Nach dem Krieg sind wiederholt „Ehemalige“ zu ihren Arbeitgebern, etwa zum Reisertaler oder zum Baumeister Braun aus Dankbarkeit und Freundschaft zu Besuch gekommen. Die Gesinnung der echten Freiheit wurde besonders in den Gemeinden Glonn, Baiern und Höhenrain hochgehalten. Daß man uns deshalb anderorts als „Glonnkosaken“ bezeichnete, tat hier niemand weh. Der Gruß blieb hier jenes „Grüß di Gott“, eine Grußform, die schon die irischen Glaubensboten aus ihren Klöstern, natürlich in lateinischer Sprache, mitgebracht hatten. Man mußte den Gruß 1945 nicht neu einbürgern.
S. 47
Der große Luftkrieg über München war hier erschütternd hör- und sichtbar. Glonn selbst blieb verschont. Brandbomben fielen am östlichen Ortsrand ins freie Gelände. Den Siegesmeldungen der ersten Jahre hat man von Anfang an mißtraut. Als ein Herr einem Bauern 1940 zurief „In Paris sind wir eingezogen“, da sagte dieser nur: „Is guat, aber i muaß arbatn, fois in Paris grod koa gscheiter Troad wachsat!“ Der Herr hat entsetzt über soviel „Gefühlsroheit“ den Kopf geschüttelt; er hat es mir selber erzählt.
Als es am Abend des 1. Mai — Schnee lag frisch auf zartem Grün — zur Maiandacht läutete, fuhren die ersten amerikanischen Panzer in den Ort. Glonn atmete auf, aber tragische Vorkommnisse beschatteten den neuen Anfang. In Berganger hatte ein paar Tage vorher ein Mädchen den Huberbauern*), einen Vater von vielen Kindern, erschossen. In Oberpframmern wurde der Glonner Gendarmeriekommissar Martin Frank von anrückenden fremden Soldaten erschossen. Mit ihm fanden 2 Gendarmerieoffiziere und 5 SS-Leute den gleichen Tod. Martin Frank hatte schon im Krieg seine Söhne verloren. Man hatte ihn am 1. Mai noch nach Egmating-Oberpframmern gerufen, weil man Ausschreitungen der Kriegsgefangenen fürchtete. Frank war ein sehr pflichtgetreuer und im Grunde gutmütiger Mann. Er hat manche im Krieg nicht angezeigt, die er hätte anzeigen müssen. Seine beiden Töchter haben die Leiche des Vaters am Ortsrand von Oberpframmern mit eigenen Händen ausgegraben und sie zur Bestattung nach Glonn gebracht. Meinem Bruder wurde 1946 übrigens nicht erlaubt, den tragischen Vorgang in seiner Broschüre „Der letzte Monat“ wiederzugeben.
S. 48
Werke einer friedlichen Zeit — 1945 bis 1974
Das Problem, Millionen von Ausgewiesenen in das brüchig und eng gewordene Haus unseres Vaterlandes aufzunehmen, konnte durch Fürsorge, Caritas und Aufopferung einzelner nicht gelöst, jedoch gemildert werden. Das ganze Volk mußte sich anstrengen und zur Anstrengung geführt werden. Die Trägheit des Herzens wird in Zeiten der Not leichter überwunden. Als viele hundert Heimatvertriebene in der Gemeinde Glonn an die Türen unserer Herzen und Häuser klopften, bekam der in Altbaiern fast heilig gehaltene Begriff der guten Nachbarschaft eine neue Dimension. Aus dem Miteinanderlebenmüssen wurde immer mehr ein Miteinanderlebendürfen. Was die einen duldeten und die anderen leisteten, wuchs zusammen. Die Einwohnerzahl stieg bis 1950 von 1800 auf fast 3000. Mochten dem Guten auch Grenzen gesetzt sein, der Glaube schärfte die Gewissen: „Kommt den Unterdrückten zur Hilfe, verschafft der Waise das Recht, verteidigt die Witwe und wenn eure Sünden wie Scharlach sind, ihr werdet weiß wie Schnee!“
Die Zuwandernden kamen nicht nur ohne ihren Besitz zu uns, sie kamen manchmal auch mit den erleichterten Schultern der aus noch größeren Gefahren Erretteten. Diese biederen arbeitsamen Nachkommen der deutschen Kulturpioniere im Südosten des Abendlandes, die vielen werktüchtigen Sudetendeutschen und die uns stammesverwandten lebensfrohen Egerländer brachten die Fähigkeiten und den Mut für einen neuen Anfang mit. Sie arbeiteten, als lebten sie ewig, und sie beteten mit uns, als stürben sie morgen. Nur ihre Kinder verloren die alte Heimatsprache. Es mochte 1949 gewesen sein, daß ich einen Buben in seinem Gehabe und seiner Erscheinung für einen „selbmzügelten“ Baierer Winkler ansah und er mir auf meine Frage nach seiner Herkunft sagte: „I bi vo Groaßroahrschdorf, aba i bi fei a Schlesia“. Rund 35 % der Einwohner waren um 1951 Heimatvertriebene und Evakuierte. Zeitweise war übrigens auch die Familie des mit den Geschwistern Scholl hingerichteten Professors Kurt Huber, des Freundes des baie- rischen Liedes und des Kiem Pauli, Gast in Glonn. Zwangsräumungen und Zwangseinweisungen konnten hier weitgehend vermieden werden; Vermittlung war das Wort.
S. 49
Der Bayerische Freistaat wurde am 28. September 1945 durch eine Proklamation Eisenhowers wieder hergestellt. Am 27. 1. 1946 fand wieder die erste freie Wahl statt. Es war die Wahl des Bürgermeisters und der Gemeinderäte. Bei der ersten Landtagswahl im Juni 1946 erhielt die CSU 695, die SPD 200, die FDP 29 Stimmen. Um diese Zeit waren die Sammellager für vom ehemaligen Feind gefangene deutsche Soldaten im Reisertal und im Bairer Winkel schon längst wieder aufgelöst. Massengefangenenlager waren in Aibling und Rosenheim gewesen.
In der Weihnachtszeit 1947 mußten die spielbegabten Glonner Buben und Mädchen mein 1946 entstandenes „Schönauer Krippenspiel“ nicht weniger als dreizehnmal aufführen, so ausgehungert nach dem baierisch empfundenen Guten und Heiteren waren damals die Menschen. Sogar der damalige Kultusminister Dr. Hundhammer sah sich am Neujahrstag 1948 mit seiner Familie das Spiel an. Es wurde sehr viel Geld eingenommen und für wohltätige Zwecke verwendet. Einmal war der Andrang so groß, daß Polizei den Aufgang zum Saal abriegeln mußte. Als die fleißigen Spieler im Sommer 1948 zur Entlohnung auf ein paar Tage auf die Hochrißhütte durften, spielten wir das Spiel unter den Blitzen und dem Donner eines mächtigen Berggewitters ohne Kostüme und ohne jede Vorbereitung den baßerstaunten Gästen vor.
Am 21. Juni 1948 wurde die Währungsreform verwirklicht. 3 Monate später gab es das erste Weißbrot, das Pfund zu 35 Pf. 1950 wurde die Lebensmittelrationierung nach über 10 Jahren endgültig aufgehoben.
Ab 1949 setzte das alte Glonner Straßenkreuz zwischen seinen vier Ausdehnungen immer schönere Strahlenflügel an. So entstand bis 1952 die neue Siedlung zwischen der Zinnebergerund der Moosacher Straße. Der qm Grund wurde anfänglich mit 50 Pf. abgegolten. Zu den ersten 11 Parzellen kamen 18 dazu, welche die Pfarrei im Erbbaurecht zur Verfügung gestellt hatte. Zwischen 1965 und 1969 wurden weitere 60 000 qm erschlossen. Eine andere Siedlung flüchtete sich in den Waldrandschatten bei der Wiesmühle; wieder eine sonnte sich auf der Höhe und freute sich am weiten Blick; wieder einer gefiel die Stille und Abgeschlossenheit auf der Hügelzunge vor dem Quellengrund. Später folgten neue Quartiere am Grottenberg, am alten Haslacher Fahrweg, an der Matten- hofener Straße und am Klosterweg. Und ganz so falsch ist es nicht, wenn Kurt Seeberger in seiner Plauderei in der Zeitschrift „Merian“ meint: „Die Ortschaft liegt verschwenderisch verstreut.“ Glonner Witz hatte für die neuen Siedlungen und für neue Bauten bald auch poetisch-wirklichkeitsbezogene Namen; da gibt es z. B. den „Schuldenbuckel“, das „Hypothe- kenbergerl“, „die Zitronenpresse“, und „die Goaßnsiedlung“ (überm Mühlthal durfte nämlich seinerzeit nur gebaut werden, wenn sich die Bauwilligen verpflichteten, einen Ministall für Kleintierhaltung mitzubauen). Ist der Ort auch weit gestreut, die große neue Friedensglocke von 1949, die junge Schwester jener von 1653, also aus derzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, klingt in Freude und in Trauer bis hinaus ins letzte Haus.
S. 50
 Das Alters- und Pflegeheim der Caritas
Das Alters- und Pflegeheim der Caritas
GR Boxhorn war für die Glocke der warmherzige Werber gewesen. Sich mit Prof. Lebsche absprechend, der Zukunft vertrauend und doch nicht auf sie bauend, gab er der Glocke als Spruch die Bitte mit: „Zögere nicht, Königin des Friedens, Dich zu erbarmen der aus den Fugen gehenden Welt!“ Wenn wir 1974 die Zeitungen durchblättern und wenn wir einen Blick auf das den Erdball wie mit einem Spinnetz überziehende System ungezählter komplizierter und sich widersprechender Bündnisse und Verträge werfen, ist dann jene Bitte nicht von einer fast bestürzenden Dringlichkeit?
S. 51
Eine Schönwetterperiode, wie die nach 1950, ist dankbar anzunehmen und für Werke des Friedens auszunützen. Von der Kirchenrestauration, von Schul-, Kindergarten- und Pfarrheim- bau haben wir schon berichtet. Ein Werk des Friedens und der Ökumene war der Bau der Evangelischen Kirche am Kugelfeld, die am Himmelfahrtstag 1969 eingeweiht wurde und die unter ihrem hohen Zeltdach der Andacht 150 Plätze anbietet. Der Glaube wird von denen gelebt, die eine Hoffnung haben.
Am 10. Juli 1967 weihte Julius Kardinal Döpfner das von der Caritas an der Rotter Straße errichtete größte Alters- und Pflegeheim der Erzdiözese München-Freising ein. Der ehemalige Pfarrherr Kemmer von Aßling freut sich ob der schönen modernen und doch heimeligen Hauskirche, die auch allen Glonnern offensteht; er gibt sich mit liebendem Eifer seinen Aufgaben hin und läßt die Gottesdienste in Ton und Bild in die Pflegezimmer übertragen. Der Neuwirtssohn Ludwig Mayer ist dem großen Haus der verantwortliche Leiter geworden. Die jungen hübschen und meist lebensfrohen Schwestern aus Kroatien aber beweisen, daß der Baum der Kirche immer noch zu blühen vermag und wäre es auch über hartem Grund. Prof. Lebsche war für das Haus erster Anreger und der erste große Spender’). Irgendwer hat einmal in Glonn das einfache aber kluge Wort gesprochen: „Ohne Glaube wären wir nichts, ohne Liebe gar nichts.“
1962-1970 wurde in 4 Bauabschnitten die Kanalisation, verbunden mit einer mechanischvollbiologischen Kläranlage, durchgeführt. Die 3360 000 DM dafür waren der größte finanzielle Aufwand, den Glonn jemals für ein Projekt aufbringen mußte. In den Sechzigerjahren wurden die Gemeindestraßen staubfrei gemacht. Seit 1959 bekamen die Straßen ihre Namen; sie sind gut gewählt und zeigen Sinn für heimatliche Tradition. Bis 1973 wurde die Straße Glonn-Haslach-Piusheim ausgebaut. 1970/72 gab es manche Kümmernisse um die- große Ortsdurchfahrt und schließlich ein gemeinsames Amen.
*) Die Architekten Walter und Motzer schufen die Pläne
S. 52
Eine Musterstraße baute der Landkreis zwischen Glonn und Grafing. In zwei eleganten Dreierschwüngen durchtanzt sie das Brücker Tal, und in der neuen Schneise durch den Zinneberger Wald leuchten an schönen Tagen ganz unerwartet die weißblauen Gebirgsfahnen des Werdenfelser Lands, „die wir vor lauter Wald sonst nie gesehen“. Wer hätte 1945 es sich träumen lassen, daß wir 25 Jahre nach dem Zusammenbruch, der ein totaler war, auf solchen Straßen fahren dürfen! Aber denke daran, daß die schönsten Straßen das Leben nicht lebenswerter machen, wenn die inneren Wege von Mensch zu Mensch steiniger werden. Do hoamat Di dann nix mehr o!
1968 wurde am Marktplatz der riesige Maibaum aufgestellt, 1973 wurde er erneuert. Im Rathaussaal aber grüßen aus der langen Reihe der Glonner Ehrenbürger auch die Bilder und Namen jener zwei Bürgermeister, welche in den Jahren von 1946 bis 1972 hier walteten: Johann Eichmeier, der mit seinen 14 Amtsjahren länger als-bisher jedes andere Glonner Gemeindehaupt im Rathaus residierte und Anton Decker, welcher 1930 als Gemeindebeamter nach Glonn kam, als solcher uns 30 und als Bürgermeister noch weitere 12 Jahre redlich und in Ehren diente.
Glonn war bis ins beginnende 20. Jahrhundert eine vorwiegend bäuerliche Gemeinde mit dem dazugehörigen Handwerk und Handel. Heute ist Glonn selbst ein anerkannter Erholungsort.
Gepflegte neue Randsiedlungen auf den ansteigenden Hügeln runden ihn ab; Heimatvertriebene, vorwiegend aus dem Sudetenland und dem Südosten, sind rührige Neubürger geworden und fügen sich gut ins Hergebrachte. Das Wirtschaftsleben floriert*). Neue Straßen verbinden freundliche Dörfer, Einöden und Nachbargemeinden mit dem Markt in der Mitte der Landschaft. Von rundum kommen die Hauptschüler in ihr neues Haus. Blumen überblühen im Sommer Gärten und Häuser. Und hat sich seit den Tagen der glonngebürtigen Lena Christ auch Vieles geändert: Glonn ist eine schöne Heimat geblieben; sie ist es wert, daß man für sie dankt.
So sei hier der Platz für einen baierischen Vers, der mir droben in der Nähe der Schießstätte einmal eingefallen ist.
Auf d’Nacht zua
Da Himmi hot sei Abendliachtn, de
Zugspitz hebt si deutli o.
Am Wendlstoa tean d’Stern scho blitzn
und schaugn mit eham ins Landl ro.
Im Toi drunt herst a große Glockn, am
Berg drobn müaassn ‘s kloane sei, dös
ois wenn da Vata vorbet* und kloane
Dirndln betn drei.
De Wöit, sie legt si hi zum Schlafa, da
Moschei rieht ihr Zuadeck hi.
I dank da, Herrgott, und i g’freu mi, daß i in
deiner schönstn Kammer, daß i in meiner
Homat bi.
*) Die Einwohnerzahl pendelt um 3800.
S. 53
Leute von Rang — Sie trugen Glonns Namen in Land und Welt
Als Professor Lebsche 1951 in festlicher Stunde zum Ehrenbürger erhoben wurde, sagte er: „Wer von unserer Talschaft ist, ist jedem anderen gleich, ohne Unterschied des Berufes, fast ohne Unterschied des Alters und jetzt auch ohne Unterschied zwischen Alteingesessenen und Heimatvertriebenen. Wir glauben das Gleiche und wir lieben das Gleiche. Und wenn einer einmal aus dem Karpfenteich herausgehoben, hergezeigt und gelobt wird, dann will er bald wieder untertauchen.“ Mir bleibt es nun doch nicht erspart, für einige Augenblicke den einen und anderen zu Glonn Gehörigen, der den Namen unserer Heimat durch besondere Begabung und Leistung ins Land oder in die Welt hinausgetragen hat, für einige Augenblicke heraufzuholen und auf den Podest zu stellen, ob sie es wollten oder nicht.
CORBINIAN SARREITER (1737-1784), Lederersohn aus Glonn, wird 1772 zum Propst des Augustiner-Chorherrnstiftes Beyharting gewählt. Es gab Zuständigkeitskonflikte zwischen dem kurfürstlichen und dem geistlichen Regiment, so wurde Sarreiter erst 1775 durch den Bischof von Freising als Propst bestätigt. Aus jener Zeit stammt eine sehr gute Rokokofigur aus der Schule Ignaz Günthers: Beyhartings schmerzhafte Madonna. Beziehungen zum Stift in Weyarn waren sicher gegeben, vielleicht sogar übr den Glonner Bäckerssohn Beregis Dötsch, der dort Chorherr war; Chorherrnstifte waren immer auch Pflegestätten der Wissenschaften und der schönen Künste. Propst Sarreiter war es aufgegeben, die durch Blitzschlag zum größten Teil eingeäscherten Klostertrakte wieder aufzubauen. Sie wurden ansehnlicher errichtet, als sie vorher waren. Daneben wandte er große Summen für die Kultivierung der von der träge gewordenen Glonn durchmoorten Gründe auf. Wohl nicht ohne Grund ließ er auch einen Hopfengarten anle- gen. Von diesem ist nichts mehr geblieben. Wohl aber blieben die prächtigen Ornate erhalten, die er für die Gottesdienste in Auftrag gegeben hatte. Sarreiter war auch ein großer Musiker, verwendete manche Summe für Kirchenmusik und schickte begabte Novizen ins Seminar nach Weyarn.
JAKOB BEHAM, der 1749 wohl beim „Maler am Berg“ (überm Mühlthal) einheiratete, und seine Söhne Johann und Michael, die sich in Aibling niederließen, haben großartige Fassadenmalereien im Leitzachtal hinterlassen. Der Jodlbau- ernhof an der Straße nach Bayerisch Zell zeigt eine der schönsten erhaltenen „Lüftlmalereien“ ganz Oberbayerns. Nach Prof. Sepp Hilz ist auch der reizvolle Widenbauernhof bei Hundham von den Behams bemalt worden. In der Eibacher Kirche dürfte sich einer von ihnen in dem bebarteten Herausschauenden auf dem Altarblatt selbst verewigt haben. Glonner Fassadenmalereien, die wohl von den Behams stammten, fielen zuletzt den Abbrüchen beim Schmied Wäsler und beim Maler am Berg zum Opfer. — Nebenbei sei hier erwähnt, daß aus dem Geschlechte eines der bei der Glonner Bauernschlacht 1632 Erschlagenen die fünf Baumeisterbrüder DIENTZENHOFER und ihre Söhne hervorgegangen sind, die dem deutschen Barock von Dom zu Fulda über die Residenz in Bamberg und das prächtige Schloß Banz übern Main bis hin zu den beiden Nikolauskirchen in Prag ihre schöpferische Kraft liehen.
S. 54
 Lüftlmalerei der Malerfamilie Beham am Jodlbauernhof
Lüftlmalerei der Malerfamilie Beham am Jodlbauernhof
Das Geschlecht der Dientzenhofer lebte auf Höfen des Gebirgsrandes zwischen Feilnbach und Brannenburg. DIE POSTHALTER WAGNERS waren durch 2 Generationen Reichs- und Landtagsabgeordnete; vor allem dem Jüngeren (1865/1912) war es zu verdanken, daß Glonn seine Bahn bekam und zum Markt erhoben wurde. In den beiden Weltkriegen fielen dessen 3 Söhne.
S. 55
 Porträtrelief (Epitaph an der Glonner Pfarrkirche) des Glonner Chronisten Pfr. J. B. Niedermair
Porträtrelief (Epitaph an der Glonner Pfarrkirche) des Glonner Chronisten Pfr. J. B. Niedermair
JOHANN B. NIEDERMAIR (13. 2. 1875/14.11. 1956) brachte 1909 als Diakon ein ganzes Tausend seiner prächtigen und für die damalige Zeit ungemein reich bebilderten Chronik von Glonn mit. Das Stück kostete ganze 2 M. 1939 wagte er es, das Buch neu und reich erweitert auf seine Kosten herauszubringen. Ich hatte ihn 1931 dazu angeregt und sicherte ihm meine Mitarbeit zu. Aber weil Heimatgeist damals nicht willkommen war und weil da und dort ein Sätzlein Wahrheit, allzu offen geschrieben, die Ohnmächtig – Mächtigen reizte, verbot die Reichsschrifttumskammer alsbald das Buch und die Polizei kam ins Haus, die schuldvoll – unschuldigen Bücher zu beschlagnahmen. Bei einem Luftangriff verbrannte ein halbes Tausend davon im Wittelsbacher Palais, dem Hauptsitz der Münchner Gestapo. Vernünftige Hände in Ebersberg verhehlten einen Teil der Bücher und ließen sie 1945 wieder ans Licht kommen. Auf einer Gedenktafel an der Glonner Kirchenmauer ist zu lesen, daß Pfarrer Niedermair im Jahre 1951 geworden ist, was er heimlich schon lange war, ein Ehrenbürger der Gemeinde Glonn. Im November 1956 starb Niedermair in seiner Wahlpfarrgemeinde in Epfenhausen am Lechrain im Alter von 82 Jahren.
Universitätsprofessor DR. MAX LEBSCHE (11. 9. 1886 / 22. 9. 1957). Der „Doktormax“ zu sein, war ihm in Glonn sein liebster und von Kindheit an vertrautester Titel. Er promoviert summa cum laude mit der Lösung einer Preisaufgabe der Medizinischen Fakultät in München – wird Feldarzt im 1. und Lazarettchefarzt im 2. Weltkrieg und Freiheitskämpfer in Schlesien. Er wird Assistent bei Prof. Sauerbruch, er habilitiert bei diesem mit einer Arbeit über die Chirurgie des Herzens. Sauerbruch bemerkt einmal: „Ich würde mich nur von meinem Freund Lebsche operieren lassen“. Lebsche wird Professor und Direktor der Chir. Universitätsklinik in der Landeshauptstadt. 1930 gründet er am Bavariaring eine private chir. Klinik und gibt ihr den Namen von Bayerns letzter Königin Maria Theresia.
In der Zeit der Diktatur bleibt er, aus dem Staatsdienst entlassen, der Ungebeugte und mutig sich Äußernde. Sein internationaler Name und seine Unentbehrlichkeit sichern ihm trotz seines Mannesmutes und seiner offenen Gläubigkeit, trotz seiner unbeirrbaren Treue zum Königshaus und seiner Hilfsdienste für jüdische Kliniken und Patienten die im Wesentlichen ungestörte Weiterarbeit in der eigenen Klinik, in der auch im Luftkriege „nie das Herdfeuer erlosch“.
Mehr als tausend Armamputierten gab Lebsche mit seiner Wiederherstellungschirurgie die Möglichkeit, im Beruf zu bleiben. Er wird Malteserritter und Ritter vom Hl. Grab, aber nicht geringer freut ihn der Lorbeerkranz mit der weißblauen Schleife, den ihm seine dankbaren Soldaten ins Haus bringen.
S. 56
Seine Reden waren von hoher sittlicher Verantwortung und von erzieherischem Ethos getragen: „Jeder von uns kann sicher noch mehr lächeln, noch mehr schenken, noch mehr verzichten, noch mehr verzeihen und noch mehr danken“.
Für Glonn war er ein immerwährender schweigender Wohltäter. Fast regelmäßig zur gleichen Nachmittagsstunde fuhr er an Feiertagen hierher, besuchte eine der Wallfahrtskirchen der Heimat, grüßte zum Abschied das Elterngrab und kehrte nach München zurück. An der Gartenmauer des Lebschehauses ist zu seinem Bilde zu lesen: „Gott sein Leben, dem Menschen sein Können, dem König seine Treue, der Heimat seine Liebe.“ – 20 Jahre nach ihm wird auch seiner geliebten Schwester Klara Lebsche ob ihrer Verdienste um die Caritas das Ehrenbürgerrecht verliehen. Sie erinnert sich an 1945: „Wir sind durch die Lager gegangen; wir waren ratlos, aber wir fingen an.“
Der letzte Generalsstabschef der Luftwaffe: General der Flieger KARL KOLLER (22. 2. 1898 / 22. 12. 1951). Als 15jähriger nimmt er Verbindung mit dem damaligen Kunstflieger Hirth auf. Von England zurückkommend, meldet er sich 1914 als Kriegsfreiwilliger. Nach mehreren Luftsiegen wird der junge Jagdflieger 1918 hinter den englischen Linien abgeschossen. Nach dem Krieg Hauptmann im Führerstab der Landespolizei und Lehrer an deren Offiziersschule. Erfolgreicher Pionier des Segelflugs, erringt er 1921 auf der Rhön mit einem Flug über mehr als 5 km Weite die Weltbestleistung.
 Der große Chirurg: Univ.-Prof. Dr. Max Lebsche
Der große Chirurg: Univ.-Prof. Dr. Max Lebsche
S. 57
 Der Generalstabschef der Luftwaffe: Karl Koller
Der Generalstabschef der Luftwaffe: Karl Koller
An der Seite Udets Chefpilot der Flugschule in Pähl am Ammersee. 1935 wird der Offizier zur Luftwaffe versetzt. Obwohl die Volksschule Glonn seine einzige ordentliche Schule war, die er absolviert hatte, schloß er (nach einem früher abgelegten Begabtenabitur) mit großartigem Erfolg die Luftkriegsakademie in Berlin ab. Er wird I a im Luftgaukommando München und im Krieg Stabschef der Luftflotte 3, die im Westen operierte. Er bewährt sich beim Durchbruch der deutschen Schlachtschiffe durch den „Kanal“ und wird Ritterkreuzträger. In der für Deutschland verzweifelten Situation im Herbst 1944 ernennt man den Aufrechten, der auch Hitler und Göring zu widersprechen wagte, und den auch das Ausland respektierte, widerwillig zum letzten Generalstabschef der deutschen Luftwaffe.
Das Verbot Hitlers, abgesprungene Feindflieger vor Lynchjustiz zu schützen, sabotierte er. Am 21. April 1945 erklärte Koller: „Die Luftwaffe ist in wenigen Tagen völlig tot“. Hitler schreit ihn an: „Man müßte die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen“. In den letzten Monaten und Wochen des Krieges ist Koller in Zusammenarbeit mit andern vernünftigen Kommandeuren mit Erfolg bemüht, durch kluge Mannöver befohlene sinnlose Zerstörungen des Landes zu verhindern.
Am 27. 4. 1945 wagt er, entgegen dem Rat seiner Offiziere, den vom „Führerbunker“ befohlenen Flug zum eingeschlossenen Berlin. 1949 veröffentlicht er unter dem Titel „Der letzte Monat“ sein Tagebuch.
S. 58
Die präzise Nüchternheit seines Berichts zerstört alle Legenden und wird in Deutschland und im Ausland als Sensation empfunden. Sein Buch dient heute noch jeder größeren Zeitgeschichte und jeder Hitlerbiographie als verlässige und detailreiche Quelle. Kollers untadelige Haltung wird heute von allen seinen ehemaligen Kameraden und Soldaten, aber auch von den ehemaligen Kriegsgegnern anerkannt. Der amerikanische Oberst Charles Lindbergh, der 1927 als erster den Ozean im Alleinflug überquerte, bekundete Koller sofort nach Kriegsende durch seinen Besuch seine Hochachtung.
1940 hatte er schon die unbedingte Schonung der großartigen französischen Kathedralen erwirkt. 1944 erreichte ihn dann die Bitte Lebsches, dafür zu sorgen, daß Ravenna mit seinen unersetzlichen Kunstdenkmalen und mit den ältesten Kirchen des Abendlandes gerettet werde. Darauf gelang es Koller, Ravenna aus der Kampflinie herauszuziehen. So ist die Erhaltung Ravennas, in dessen Kirchen, Baptisterien und Mausoleen jugendfrisch die Mosaiken des 4. Jahrhunderts leuchten, dem Verantwortungsbewußtsein und dem Mut zweier Glonner Landsleute zu verdanken. Zugleich hat Koller in einer langen Kette von Fällen (von 1933 bis 1945) Soldaten und Zivilisten, auch solchen aus der Heimat, vor KZ und Kriegsgericht bewahrt.
Nach dem Kriege gelangte er als maßvoller Vorsitzender des Bay. Soldatenbundes in den Mittelpunkt des politischen Interesses und Bonn dankte ihm, daß er damals zur Entspannung der außenpolitischen Lage beigetragen habe. Da maßgebende Männer der großen Parteien eben daran dachten, Koller beim Aufbau der Polizei oder der Luftwaffe führend einzusetzen, starb er plötzlich im 53. seiner Jahre. Er war ein Opfer der Strapazen seiner Stellung und seiner immerwährenden Hilfsbereitschaft geworden, für welch letztere seine Mutter allerdings immer die wärmste Fürsprecherin gewesen war. Die Gemeinde bereitete ihm eine Ehrengruft und der Bürgermeister sprach an dieser die Worte: „Der General Koller tat alles aus dem Geiste der Heimat und deshalb steht die Heimat zu ihm.“
Der Lyriker BERHARD KOLLER, ein jung Vollendeter (19.12.1934/13.6.1955): „Seine Gedichte geben diesem jungen Menschen einen hohen Rang als Dichter, einen Platz auf dem deutschen Parnaß“, so Carl Amery in der mehrmals wiederholten Hörfunksendung „Efeu für einen Jüngling“. Das Bayerische Fernsehen ließ durch Pieter Koch einen künstlerisch hervorragenden Film schaffen und zeigte ihn mehrmals. Er trug den Titel „München, die Stadt des Bernhard Koller“. Der Film, brachte auch einmalig schöne Bilder aus der Glonner Landschaft, in ihr wuchs Bernhard auf, in ihr hat er seine Ruhestätte gefunden. „Sein Tod unterbrach einen Aufstieg, der weit in die Sterne geführt hätte.“ 1960 brachte die Stifterbibliothek in einer für moderne Lyrik ganz ungewöhnlich großen Auflage seine Gedichte, seine Essays und Auszüge aus seinem Tagebuch heraus. Das Buch ist heute vergriffen. Einzelne seiner Gedichte wurden in fremde Sprachen übersetzt, andere wurden vertont.
S. 59
Abschied
die stadt ist für den abschied angetan.
der letzte händedruck
geschieht schon ohne äugen.
der träum der nachtviole
hat keine flügel mehr:
an ihrem blassen abend
wurde die dunkle hoffnung verloren.
die augenlosen Schemen
gehen mit rührenden armen die
blasse Straße auf und ab.
Bernhard Koller
S. 60
Lena Christ – Der Glanz ihrer Werke und ein merkwürdiges Leben
 Lena Christ, etwa 17 Jahre alt
Lena Christ, etwa 17 Jahre alt
Lena Christ (30.10.1881/30. 6.1920), als lediges Kind der Hausschusterstochter Magdalena Pichler, damals Köchin auf Zinneberg, am 30. Oktober 1881 in Glonn geboren und mit dem selben Namen wie ihre Mutter beim Standesamt eingetragen. Der Schmiedgeselle Karl Christ aus Mönchsroth bei Dinkelsbühl bekennt sich zur Vaterschaft. Angeblich ist er dann auf der Überfahrt nach Amerika mit dem Schiff Cimbria untergegangen. Die erst jetzt wieder aufgefundene Passagierliste dieses Schiffes enthält nicht seinen Namen. 7 glückliche Kinderjahre verbringt das Lenerl bei seinen Großeltern in Glonn. Als die Mutter heiratet, holt sie das Dirndl nach München. Mißverständnis und Unglück beginnen. Die Eltern arbeiten sich als Wirtsleute empor; der Stiefvater Josef Isaak ist gut zum Lenerl. Die Mutter aber kommt zeitlebens aus einer Art Haßliebe nicht heraus. Das Warum läßt sich kaum mehr ergründen. Vielleicht ist auch Sorge um das nichtverstan- dene Kind im Spiel. Lena Christ ist zeitlebens zwiespältig in ihren Anlagen und inneren Bewegungen, unsicher in der Wertung ihrer Mitmenschen, unkritisch in ihren raschen Entschlüssen, heftig gegen Widerstände, entflammbar und verbrennbar zugleich. Nach schweren Ausschreitungen der Mutter gegenüber der Tochter darf das Lenerl 1892 auf ein Jahr nochmals nach Glonn.
Wenn das Lenerl aus dem Haus ist, holt sie die Mutter, vielleicht um des Ansehens willen immer wieder heim, so von Glonn, so später von Urs- berg, wo die Lena, denkbar dafür ungeeignet, als Novizin sich versuchte und schließlich von der Gaststätte Floriansmühle in Freimann, welche die neunzehnjährig gewordene Leni als hübsche und beliebte Bedienerin gerne behalten hätte. Fast ohne eigenes Zutun läßt sich diese 1901 mit dem Buchhalter Anton Leix verehelichen. Dieser kommt später in finanzielle Schwierigkeiten und vor das Gericht. Nach 8 Jahren Ehe trennt sich Lena von ihm, gerät in große Not, nimmt Schreibarbeiten an und wird durch den Schriftsteller Peter Jerusalem, der sich später Benedix nennt, zur Niederschrift ihrer Erinnerungen veranlaßt.
S. 61
Das Buch erscheint 1912. Deutlich, unreflektiert, schonungslos gegen ihre Mutter und gegen sich selbst, erzählt sie ihr Leben, und in einem bei uns damals kaum bekannten Naturalismus die menschliche und sexuelle Tragödie ihrer Ehe. In ihrem Manuskript ist kaum etwas korrigiert und doch ist kein Wort zu wenig und keines zu viel. Wie wenig erzählt sie z. B. von ihrem Großvater, ein paar Geschehnisse, ein paar Gespräche, aber schon steht ein warmes Menschenbild vor unseren Augen, und unser Herz schlägt dem guten brauchbaren Manne zu, der seine Hand und Liebe dem Lenerl leiht und ihm Rat und Wegweisung gibt.
Sie heiratet 1912 Peter Jerusalem und schreibt ihre Glonner „Lausdirndlgeschichten“. Die Geschichten sind erlebt und drauf loserzählt; aber Thoma verübelt sie ihr; denn vorher sind seine „Lausbubengeschichten“ erschienen und diese waren in ihrer gemachten Naivität wirksamer gewesen.
Den Kriegsausbruch erlebt die Familie Jerusalem in Lindach bei Glonn. Kriegsanfang und Spionenfurcht sind in „Unsere Bayern anno 14” nach wirklichen Erlebnissen köstlich geschildert. Das Buch brachte den ersten wirtschaftlichen Erfolg („Die Erinnerungen einerüberflüssigen” hatten nur die Kritik aufhorchen lassen). Der König lud sie an seinen Tisch, wo sie so unbefangen erzählte, daß die Prinzessinnen abwechselnd bleich und rot wurden. 1914 vollendet sie ihr innigstes Buch, und sie heißt es zu Ehren ihres Großvaters „Mathias Bichler”. Sie selbst nennt sich als Schriftstellerin Lena Christ; keines ihrer Bücher verdient diesen schönsten ihrer vielen Namen (Pichler, Leix, Jerusalem) mehr als dieses. In der Gestalt des Mathias Bichler, der ein Findelkind war, aber nach schweren Jahren sich zu einem angesehenen Bildschnitzer emporarbeitet, hat sich Lena selbst ins Männliche übersetzt. Mit unerhörter Sicherheit bedient sich die Dichterin eines Chronikenstils vom Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Erzählung von der „Rumplhanni“ schreibt sie großenteils in Lindach nieder. Das nicht sehr umfangreiche Buch wird geradezu eine klassische bäuerliche Dichtung. Die Geschichte spielt in den ersten Kriegsjahren. Schauplätze sind die Bauernlandschaft zwischen Glonn und Aibling und die Stadt München. Die Hanni, die Magd, ist ein gar abgründiges, aber doch ein stichhaltiges Frauenzimmer, und darum weiß sie sich, vom Hofe verjagt und ins Gefängnis gekommen, endlich ins Leben zu finden, kann Schuld und Schicksal unterscheiden und vermag an der Seite eines Münchner Wirts ein sicheres und helleres Dasein zu gewinnen. Ein urwüchsigerer Dialog als der in der „Rumplhanni“ ist in baierischer Mundart nie geschrieben worden.
Neben der Triologie ihrer großen Werke hat die Christ ein einziges ganz abgrundfernes, lockeres und heiteres Buch geschrieben die „Madam Bäuerin“. Aber nun zerbrechen ihr Liebe und Leben.
S. 62
Peter Jerusalem rückt ins Feld. Lena ist wieder lungenkrank. Sie verliebt sich in einen jungen Sänger, den sie bei Lesungen in einem Lazarett kennengelernt hat. Er versteht nichts von dem Großen und dem Gefährlichen in dieser Frau. Er entzündet in ihr ein Feuer, aber kein erwärmendes, läuterndes, helfendes, sondern ein verzehrendes.
In bedrängtester Lage begeht sie eine Torheit, die sie selber wohl am wenigsten begreift. Sie fürchtet nun für ihre Kinder die öffentliche Schande. Sie hat 1919 ihr Schicksal vorausgeahnt, als sie schrieb: „… daß sich das Glück
allmählich von mir wenden wird, weiß ich bestimmt. Ich falle eben doch dem Schicksal anheim, welches mir meine Mutter (es war an Lenas Hochzeitstag im Jahre 1901 gewesen) gewünscht hat“.
Ohne jede Hoffnung auf Hilfe ordnet sie ihren Abschied, fährt am Morgen des 30. Juni 1920 mit der Straßenbahn zum Harras, geht dann zu Fuß weiter, versöhnt sich gläubig-kindlich mit ihrem Herrgott und nimmt im Waldfriedhof an einem ihr vertrauten Grabhügel das tödliche Gift.
Merkwürdige, vorher vereinbarte Zeichen nach ihrem Tode bestätigt Benedix in seinem Werk „Der Weg der Lena Christ“. „Zuletzt erhielt ich eine Bestätigung in einer Form, die so einwandfrei nur von ihr stammen konnte, daß ich dadurch die absolute Bestätigung von einem persönlichen Fortleben nach dem Tode erhielt, bis ich eines Tages laut bat, wenn sie es wäre, möchte sie um der Kinder willen aufhören. Von dem Augenblick trat Ruhe ein.“ Josef Martin Bauer bekannte, daß er den Bericht von Benedix für äußerst glaubwürdig halte und daß die Lena nach ihrem Tode noch „Proben ihrer Macht“ gegeben habe.
Über ihrem Grab rauschen die Bäume der Heimat und der Dornengekrönte sieht auf ihren Hügel, unter welchem auch ihre jüngste Tochter ruht, die ihr nachfolgte. Lena Christ, heute als eine der großen Dichterinnen Deutschlands anerkannt, hat viel Dunkel durchlitten, aber die Heimat hat sie reicher gemacht.*)
*) 1971 wurde in der Lena-Christ-Straße von der Familie Kronthaler die Lena-Christ-Stube errichtet. Zu ihrer Ausstattung hat der Schriftsteller Günter Goepfert zahlreiche Bilder und Dokumente beigebracht. Persönliche Erinnerungsstücke aus dem Nachlaß der Dichterin stellte ihre Tochter Frau Lena Dietz zur Verfügung. Zu Lena Christs SO. Geburtstag veranstaltete die Marktgemeinde Glonn mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Glonn, unterstützt vom Kulturverein Zorneding, eine Gedenkfeier. Erstmals nach ihrem tragischen Tod wurde ein öffentlicher Gedächtnisgottesdienst gefeiert. Hernach erfolgte die Einweihung der Lena-Christ-Stube. Die Festrede im übervollen Neuwirtssaal hielt der Verfasser dieser Schrift. Günter Goepfert zeigte Bilder aus dem Leben der Dichterin. Aus Goepferts Feder erschien die mit großer Sorgfalt und Objektivität geschriebene reichbebilderte Biographie „Das Schicksal der Lena Christ“.
S. 63
Kunst und Literatur der Gegenwart
Der Komponist Professor GÜNTER BIALAS. Am 19. 7. 1907 in Ostoberschlesien geboren, wird er im Krieg durch seinen Unteroffizier Walter von Cube auf die Tal- und Hügellandschaft um Glonn aufmerksam. Nach 1945 wird Glonn seine Wahlheimat. Zunächst in einem nüchternen Raum wie in einer Mönchszelle eingeschlossen, blühen ihm hier, wie seltene und und uns Glonner noch fremde Blumen, die ersten Nachkriegskompositionen auf. Später baut er sich am Talrandhang bei Haslach sein Haus, und in Glonn entstehen trotz der zwölf Professorenjahre an der Musikhochschule in Detmold alle seine bedeutenden Werke. Hinde- mith hat den jungen Bialas stark beeindruckt, später bewegten ihn mehr Arnold Schönberg, Alban Berg und Igor Strawinski. 1959 folgt er einem Ruf an die Staatl. Hochschule für Musik in München und wird den „Kompositeuren“ einer neuen Generation der tolerante und doch prägende Lehrer. Ihm selbst leihen große Dichtungen der Welt Stoff für konzertante, oratorische und bühnenmusikalische Gestaltungen. Seiner erfolghaften Oper „Hero und Leander“, „die in einer mageren Musiktheaterzeit geradewegs und ohne Zwielichter Neues zu sagen hat“, folgt die poesievolle Liebesmär „Aucassin und Nicolette“, (Tankred Dorst schrieb dazu das dichterisch-feine Libretto). In Münchens schönstem Theater, in dem von Cuvillies, wird sie uraufgeführt. Bialas ist Träger mehrerer Kulturpreise und Mitglied der Bay. Akademie der Schönen Künste.
Dem bloßen Experimentieren fern und nicht mit der Standortlosigkeit liebäugelnd, eigenständig, stark im Ausdruck, maßvoll in der Wahl der Mittel, in der Vitalität von hohem Kunstverstand gezügelt, apart in den Farben und lyrisch oft schön, so zeigt sich heute das überschaubare und manche Möglichkeiten der weiteren Entfaltung offenlassende Werk dieses Komponisten. Er ist aus der Stille herausgetreten, und wir ahnen, was wir an diesem im Umgang mit uns so liebenswürdig-bescheidenen Menschen, Künstler und Mitbürger haben.
WALTER VON CUBE (geb. 1906) ist des lange überlegten geschliffenen Wortes mächtig. Er fand in den Jahren der Diktatur in Loibersdorf und Glonn willkommene Zuflucht. Er wurde ab 1948 Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks und später dessen Programmdirektor und sein farbigster Kommentator. Er ist ein überzeugter Verfechter eigenständiger bayerischer Kultur. Er ist Träger des Bay. Verdienstordens. — Sein Bruder HELLMUT VON CUBE (geb. 1908) wählte sich für viele Jahre Balkham als sein Domizil. Er schrieb Feuilletons (auch solche über Glonn), lyrische und erzählende Bücher und schuf zahlreiche dichterisch-empfundene und ebenso gestaltete Hörspielbearbeitungen. Er wurde 1963 mit dem Kulturpreis der Stadt München ausgezeichnet.
Professor HANS KIENER (1891/1964), Schüler des großen Kunsthistorikers Wölfflin, empfand Glonn als vielgeliebte Wahlheimat; er war 21 Jahre Lehrer für Kulturphilosophie und Kunstgeschichte an der Münchner Akademie für angewandte Kunst gewesen und schrieb zahlreiche Monographien. Durch seine Vorträge und Kunstfahrten war er für Glonn der willkommenste Lehrer.
S. 64
Professor THEODOR GEORGII, Schüler und Schwiegersohn des berühmten Bildhauers Adolf v. Hildebrand, lebte in Höhenrain und ist dort begraben. Er schuf 1956 für das Lena- Christ-Haus eine Gedenktafel mit dem Profilrelief der Dichterin. — Seit 1965 arbeitet der Bildhauer BLASIUS GERG (geb. 1927 in Lenggries) in seinem großräumigen Atelier an der Straße nach Haslach. Er war Schüler von Prof. Hiller an der Münchner Akademie, hat sich dann aber konsequent mit seinem menschlichen Gespür und Temperament zum eigenständigen und eigenwilligen Werk emporgerungen. Er wird vorwiegend für bildhauerische Arbeiten an und in öffentlichen kirchlichen und weltlichen Architekturen beansprucht. Er hat sich als moderner aber nicht alle Tradition verleugnender Künstler einen Namen gemacht.
GEORG LANZENBERGER (geb. 1897 in Glonn) wählte im Frühjahr 1914 mit seinem Schulkameraden Karl Koller England zum vermeintlichen Sprungbrett in die weite Welt. Während Koller Ende Juli 1914 mit dem letzten Schiff nach Deutschland übersetzte, wurde Lanzenberger vom Krieg überrascht und interniert. Im Lager begegnete er dem Bildhauer Prof. Bredow und entdeckte seine eigenen Neigungen und Anlagen für Pinsel und Stift. Ab 1919 wurde er an der Akademie für angewandte Kunst in München Schüler des bedeutenden Malers Willy Geiger und des großen Graphikers Gulbranssohn. 1932 erwirbt er das Forsthaus in der Filzen. Kein anderer Maler hat jemals unserer Landschaft so viele Bilder abgewonnen wie er. Jeder Scharlatanerie abgeneigt, widerstand er allen Modeströmungen und blieb vor der Natur sich selber treu. Früher auch gern in Freskomalerei tätig, hat er sich in den letzten Jahren mit Erfolg einem intimeren volksnahen Metier zugewandt, der Hinterglasmalerei. Im Glonner Schulhaus hat er übrigens in einem Wandbild die heimischen Tiere dargestellt und dabei auch einem der seltensten Geschöpfe der Glonner Fauna, dem „Kreißn“, eine bleibende Heimstatt gesichert.
 ..Winter bei der Christl-Mühle“ – Bild von Georg Lanzenberger
..Winter bei der Christl-Mühle“ – Bild von Georg Lanzenberger
S. 65
Schulhaus hat er übrigens in einem Wandbild die heimischen Tiere dargestellt und dabei auch einem der seltensten Geschöpfe der Glonner Fauna, dem „Kreißn“, eine bleibende Heimstatt gesichert.
WILLI KRUSE, geb. 1910 in Herford, Westf., fand ab 1943 in München und Kastenseeon eine neue Heimat. Er war Meisterschüler von Prof. Schinnerer und studierte auch bei Heß und Carl Caspar. Im In- und Ausland erstaunlich oft mit Preisen ausgezeichnet, hat er sich zunehmend der eine strenge und klare Form verlangenden Kunst des Holzschnitts zugewandt und sich damit einen Namen weit über unsere Grenzen hinaus gemacht. — EDGAR ENDE (1901 / 1965), einer der bedeutendsten deutschen Surrealisten, lebte jahrelang still zurückgezogen und seinem hintergründigen Werk hingegeben im ehemaligen Netterndorfer Schulhaus. Er fand in Antholing sein viel zu frühes Grab.
MAGDA GÜRTELER (geb. 1941 in Glonn) ist als Graphikerin, Malerin und Tonformerin in München tätig; einen kleinen Wettbewerb für sich entscheidend, schuf sie das schriftkräftige und farbenschöne Glonner Jubiläumsplakat. Sie besuchte 8 Semester die Kunstschule Blocherer.
ELISABETH HÜLLER, Arztensgattin in Glonn, bildete sich in ihrer Jugend bei einem der letzten großen Nachfahren der Leibischule, bei Prof. Thomas Baumgartner in Kreuth, zu einer formsicheren Porträtistin heran. Ihr Sohn Martin wurde Graphiker.
Die Professorin ELSE JASKOLLA, Textilkünstlerin von Rang, lebte während und nach dem Kriege bis zu ihrem Tod in Glonn. Werke von ihr erwarb auch das Bay. Nationalmuseum. — Unter den Malern aus der großen Tradition der naturalistischen Münchner Schule, die sich von unserer Landschaft begeistern und dann auch zu Bildern anregen ließen, finden sich der kultivierte, lyrisch gestimmte OTTO MILLER-DIFLO; der feine Nachromantiker K. H. MÜLLER-SAMERBERG; der still- besinnliche HANS STADLBERGER (malte u. a. die alte Lena-Christ-Straße); der bekannte Tiermaler und Landschafter M. M. KIEFER; der namhafte Freskant Prof. OSKAR MARTIN-AMORBACH (Fresken von ihm finden sich in der Schlachter Kirche); der temperamentvolle Prof. HERMANN URBAN, und der so naturnahe LUDW. BOLGIANO (von ihm fanden sich ausgezeichnete Bilder Glonner Motive in Münchner und Aiblinger Ausstellungen). Der begabte und zu Unrecht als ein Maler des „Tausendjährigen Reiches“ oft zitierte Maler SEPP HILZ (er schuf kein einziges politisches Tendenzbild!) hatte eine besondere Neigung zum Glonner Land und zu seinem Menschenschlag. Er malte hier u. a. „Die Waslmühle“, „Das Seilerhäusl“ und „De Soalamuatta“.
Als Kirchenmaler und vielbeschäftigter Restaurator arbeitet heute der noch relativ junge HELLMUT KNORR. — Aus einem Glonner Malergeschlecht des 19. Jahrhunderts hervorgegangen ist der sehr junge Kunstschlosser PETER MESSNER. Er ist 1967 Landessieger der Handwerksjugend und 1968 mit seiner kunstgeschmiedeten Weltzeituhr 2. Bundessieger geworden.
S. 66
 „Frauenreuther Sommer“ – Zeichnung von Hans Stadlberger
„Frauenreuther Sommer“ – Zeichnung von Hans Stadlberger
S. 67
Das Schloß auf dem Berg und seine Geschlechter
Die Preysing
Rein urkundlich ist Zinneberg erst sehr spät in die Geschichte eingetreten: Ein Friedrich von Preysing zu Zinnen kommt 1235 in einem Turnier zu Würzburg vor. Über das wirkliche Alter eines Herrensitzes auf Zinneberg wissen wir nichts. Der Sage nach sollen schon die Römer die Bergnase überm Glonner Tal befestigt haben. Burgen aber entstanden vielfach in der Ungarnnot des 10. Jh. Der Name „Zinnenberg“ dürfte von den Zinnen im Wappen der Preysing kommen; dies ist jedenfalls auch die Meinung der Gräfin Maria Theresia Arco-Zinneberg, die übrigens eine geborene Gräfin Preysing und mütterlicherseits eine Enkelin des letzten bayerischen Königs ist.
 Totenschild der Pienzenauer in der Klostekirche Ebersberg
Totenschild der Pienzenauer in der Klostekirche Ebersberg
Die Pienzenauer
Etwa um 1350 heiratete ein Otto von Pienzenau zu Wildenholzen eine Preysing und wird Herr auf Zinneberg. Immer wieder von Kinderlosigkeit betroffen, wechseln in den nächsten zwei Jahrhunderten fast regelmäßig die Linien des Pienzenauerschen Geschlechts. Dieses hatte viele Burgen, Hofmarken und Schlösser und in Ebersberg ihre bedeutendste Grablege. Ein Otto von Pienzenau starb 1371; „der gar frum Ritter“ erhielt in der Kirche zu Ebersberg einen Gedenkstein, der ein hohes Werk der damaligen Bildhauerkunst ausmacht. Bebartet und eisengepanzert steht er in Lebensgröße vor uns, derweil daneben seine Schwiegertochter Katharina vor soviel Gerüstetheit gar demütig den Blick auf ihre gefalteten Hände senkt. Ein Grabsteinfragment in Zinneberg hatte früher in der Glonner Kirche seinen Standort.
Ein Pienzenauer war im 14. Jh. Abt in Rott am Inn, und wiederum ein Otto von Pienzenau leitete von 1308 — 1326 das Augustinerchorherrenstift Beyharting. Seine Konventualen bezeich- neten ihn als „honorabilis, religiosus et devo- tus“ (= verehrungswürdig, fromm und ehrfürchtig). 1405 stiftete ein Pienzenauer in Altenburg eine Ewige Messe; ein eindrucksvolles Holzschild mit den drei goldenen Ballen auf schrägem Band erinnert heute noch daran. Eine Anna von P. errichtet im 16. Jh. das Kloster Reutberg. Sie war hier nicht allzuweit vom Stammsitz ihres Geschlechtes, dem heutigen Klein- und Großpienzenau zwischen Weyarn und Miesbach entfernt.
Georg von P. auf Wildenholzen lebte mit der Hauspflegerstochter Afra Grundinger aus Höhenrain zusammen, heiratete sie und hing der luthrischen Lehre an. Er starb 1556, nachdem er seinen Bruder, seine Frau und die Grundholden zu Erben eingesetzt hatte. Afra schrieb 1560 ihren letzten Willen nieder. Sie wollte „nach diesem zergänglichen Leben in Bruck hinter der Kirch christlich und ehrlich begraben sein“, über ihre Bahre sollten 4 Ellen gutes schwarzes Tuch gedeckt werden, welches alsdann dem Pfarrer zu schenken war.
S. 68
Reichlich bedachte sie den unehlichen Sohn ihres Gatten, den Hans Langenecker von Höhenrain, Kind einer Bauernmagd, ebenso dann einen „Doblberger“, der „seiner Sinne beraubt“ war. Auch sollte ein Haus für Sieche gebaut werden. Als Afra, nach der Überlieferung von Trauer und Schwermut um den Tod ihres Mannes geplagt, von Tränen erblindet, 1566 vom Turm in den Tod stürzte, hinterließ sie 3000 Gulden in bar, viel Silber, 2157 Ellen Leinen, Hanf und Flachs in Menge. 1825 verfügte die Stiftung zugunsten der Grundholden über die Zinsen aus 25 000 Gulden und über die ständigen Einnahmen von Vogtei und Bodenzins. In Notfällen wurde geholfen, bei Hochzeiten beigesteuert, studierende Theologen (wenn keine protestantischen vorhanden waren, durften sie auch katholisch sein) bekamen Stipendien. Die den letzten zwei unseligen Kriegen folgenden Inflationen zerstörten das Vermögen. Die letzten Schenkungen erfolgten 1941. 1816 war die Burg abgebrochen worden, nur die reizvolle Burgkapelle blieb erhalten. Den Pienzenauern zu Ehren erhielt ein neuer Ort zwischen Alxing und Taglaching deren Namen.
Im Dienst der Wittelsbacher war 1504 ein Hans von P. Kommandant der Festung Kuftstein. Er verteidigte sie mit Mut und Übermut gegen das Heer des Kaisers Maximilian. Dieser ließ die größten Geschütze jener Zeit, den „Weckauf“ und den „Purlepautz“ anfahren; mit Steinkugeln schoß man Löcher in die Mauern. Aber der Pienzenauer ließ dem Kaiser zum Hohn mit Besen lustig die Löcher auskehren. Das sollte ihm schlecht bekommen. Die Festung fiel. Mit den Kufsteiner Ratsherrn und einigen Mitkämpfern wurde er enthauptet. Der Volksmund schreibt ihm — wie später dem Tiroler Helden Andreas Hofer — ein Scheidelied zu: „Gib Urlaub, lieb weiten, Gott gsegne dich, Laub und Gras.“ Vielleicht kannte der wackere Schloßhauptmann die Ballade vom „Peter Unverdorben“ aus Neunburg vorm Wald, die mit ihren schönen Gebets- und Abschiedsformeln damals sicher weit verbreitet war und die ähnliche Zeilen enthält.
Die Grafen Fugger
1596 stirbt „der Edl und Vest Hanns Warmmundt von Pientzenau zu Zinenberg“, in Bayern gewester Truchseß. Aus seinem Rotmarmorstein in der Glonner Kirche, schon im Geschmack der beginnenden Renaissance gestaltet, kniet er mit seiner Gattin unter Sonne und Mond zu Füßen des Gekreuzigten. Seine eh-liche Hausfrau war Anna Münchin, mit der Warmmundt hier „eine freliche aufersteung“ erwarten wollte. Aber nie hat ein Steinmetz das Sterbedatum der Münchin in das ausgesparte schmale und schon quadratierte Band geschlagen. Anna ehlichte nämlich 8 Monate nach dem Tod ihres ersten Gatten den Grafen Konstantin Fugger zu Kirchberg und Weißenhorn und wurde einstens vielleicht auch in der Glonner Kirche, aber in einem Fuggerschen Grab bestattet. Konstantin war genau 100 Jahre später geboren als sein Ahne, der als armer Webergeselle durch Fleiß und Tüchtigkeit in Augsburg den Reichtum und Ruhm seines Geschlechtes begründet hatte. Konstantin Fugger war bei der Verehelichung erst 27 Jahre alt! Wie jung oder alt mag dann die Anna Münchin gewesen sein und was werden die wirklichen Beweggründe gewesen sein, daß sie ihrem Vorsatz als eine Pienzenauerin zu sterben, nicht treublieb?
S. 69

Grabmal des „Edel und Vest Hanns Warmunndt von Pientzenau Zu Zinenberg“
Ab 1552 war Philipp Appian durch viele Sommer im Auftrag des Herzogs mit seinen Meßgehilfen und Zeichnern durchs Land gezogen, es genau zu zeichnen und zu beschreiben. Er kam auch nach Glonn und nennt Zinneberg eine „arx magnifika i monte“, das ist eine großartige Burg auf dem Berg.
Die Fugger auf Zinneberg waren strenge und rechthaberische Herren. So gab es nicht wenig Prozesse zwischen ihnen und der Glonner Kirche und den Bauern. Aber zu Ehren jener Zeit läßt sich feststellen, daß die Gerichte damals zwar sehr langsam, aber doch gewissenhaft und unparteiisch Recht übten. Zunächst freilich mußten die Grafen auf dem Schloß und das Volk im Tal den Dreißigjährigen Krieg gemeinsam überstehen. „Beim ersten schwedischen Einfall“, also wohl 1632, ist nach Wening mit Glonn auch die Burg in Brand und Ruin geraten; sie wurde aber 1640 wieder aufgebaut. 1632 wurden Fuggerische Reiter bei Ebersberg von Schweden überrascht und teilweise niedergemacht oder gefangen genommen. Doch sind damals von einem Rittmeister Riederer von Paar in der Nähe von Zinneberg auch 25 Schweden getötet und 90 Pferde erbeutet worden.
S. 70
Um 1700 zeigen die Kupferstiche von Wening, daß Zinneberg damals noch immer die typischen Merkmale einer mittelalterlichen Burg aufweist, den geschlossenen Block der Gebäude und die Spuren einer vormals noch stärkeren Einwehrung. In seiner „Topographie von Baiern“ heißt es bei Wening: „Zünnen- berg, ein Viertelstundt von Glon, alwo die Straß von München nach Rosenheim gehet… auf alte Manier erbauet, sodaß die Herrschaft immer etwas daran zu richten und zu bauen hat“.
Die Arcos
1795 erlosch die Zinneberg’sche Linie der Fugger. Graf Emmanuel war unverheiratet geblieben. Nach den Aufzeichnungen von Lehrer Dunkes hat Ritter von Kern von Höhenrain zeitweise die Administration innegehabt. Entgegen fast allen bisherigen Niederschriften ist der Zinnebergsche Besitz nicht 1804, sondern erst am 28. Februar und 3. März 1825 hypothekenfrei übergegangen an Maria Leopoldina Churfürstin von Bayern“. Die Umschreibung wurde am 3. Juli 1827 genehmigt. 1850 zählte der Schloßgarten 3 Tagwerk, der Hopfengarten 2, der Hundezwinger und das Jägerhaus in der Filzen weniger als eines, der Wald „mit Holzschlag und Unterhausgehölz 373“, „der See „mit“ Fischwasser auf der Glonn und Reicher- thaller Bach“ (sicher der Bach im Reisertal!) 27, der Acker aber 105 Tagwerk. Die niedere Gerichtsbarkeit hatte Zinneberg über 71 Ortschaften.*)
Der Verkauf von Zinneberg durch die Arcos an den Markgrafen Pallavicini ist nicht, wie bisher meist falsch angegeben, 1848 erfolgt, sondern mit Urkunde vom 28. 12. 1850. Die im 19. Jahrhundert üblich gewordene Schreibweise Zinneberg ist historisch und sprachlich falsch. Nach dem altbaierischen Sprachempfinden richtig hieß es früher stets Zinnenberg.
Die Kurfürstin Maria Leopoldine hatte sich 1804, fast 6 Jahre nach dem Tod Karl Theodors, mit Ludwig Graf v. Arco verehelicht. Ihr vom Glanz der Herkunft bestrahltes, vom Schicksal geschütteltes und für die Existenz Bayerns bedeutendes Leben verlangt und verdient es, in einem eigenen Kapitel beschrieben und gewürdigt zu werden.
Hier sei aber vorher noch die Geschichte der Arcos und der ihnen nachfolgenden Herren auf Zinneberg kurz dargestellt.
Aus der Ehe der Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine mit Graf Ludwig Arco entsprossen 2 Kinder: Aloys Nikolaus, 1808 geboren auf Schloß Steppberg (verehlicht sich 1830 mit Irene, Markgräfin von Pallavicini, stirbt 1891 in Anif) und Maximilian Joseph, geb. 1811 zu Steppberg (verehlicht sich 1833 mit Leopoldine, Gräfin von Waldburg zu Zeil, stirbt 1886 in Meran). Dieser Graf Max von Arco wird von seiner Mutter später mit dem Schloß Zinneberg bedacht. Während Graf Aloys nur eine Tochter erhält, die ihrerseits in ihrer Ehe mit einem Garfen von Moy ohne Nachkommen bleibt, wird Graf Max von seiner Frau von 1834 bis 1852 mit 13 hübschen Kindern beschenkt.
*) Mitten in Glonn stand an Stelle des heutigen „Neubäck“ (Gürteler) das Zinnebergische Gerichtsdienerhaus.
S. 71
 Zinneberg 1827 — Bild von F. Kirchmair
Zinneberg 1827 — Bild von F. Kirchmair
S. 72
mit 13 hübschen Kindern beschenkt. Deren Jugendbildnisse sind in entzückenden Biedermeierminiaturen erhalten geblieben. Nur das 4., 6. und 7. Kind sind in Zinneberg selbst geboren worden. Der Sohn Nikolaus stirbt im Kriege von 1870 an seiner Verwundung, sein älterer Bruder Karl erliegt 1873 der Cholera. Ludwig (1840 / 1882) wird der Großvater aller „Maxirainer“.
Graf Max, also der Vater der eben Genannten, wird vom König 1834 der Name Graf Arco von und zu Arco-Zinneberg zugesprochen. Er war ein leidenschaftlicher Liebhaber der Natur und des Wildes und nicht der wilde Jäger, zu dem ihn, den sogenannten Adlergraf, die Sage und der Roman Hubertus von Ganghofer (hier Graf Egge genannt) umstilisierten. Er ist auch nicht bei einem Adlerstieg erblindet, sondern er verlor durch einen Schlaganfall zeitweilig das Augenlicht. Das Geschlecht der Arco kommt aus dem Tal von Arco nahe am Nordufer des Gardasees. Es stand schon seiner geographischen Lage nach immer wieder im politischen Zwielicht, galt den einen als franzosen-, den anderen als habsburgerfreundlich. Ihr Stammsitz war eine große stattliche Burg. Dürer hat sie 1495 gemalt. Die Franzosen haben sie Jahrhunderte später geschleift. Erst Ende des 17. Jahrhunderts kamen die Arcos durch Freundschaft mit dem Kurprinzen nach Bayern. Dem Kurprinzen zu helfen, heiratete ein Ferdinand Arco dessen Mätresse. Im spanisch-bayerischen Erbfolgekrieg wurde er auf dem Rückzug von Innsbruck erschossen. Die Tiroler verwechselten ihn mit dem Kurfürsten, da die Farben der Arcos Blau und Gelb den bayerischen ähnlich sahen.
Im Leben des jungen Mozart hat ein Arco eine unrühmliche Rolle gespielt. Es war ein unbeherrschter Offizier des Bischofs in Salzburg, er hat Mozart grob behandelt; er wollte das aufsässige junge Genie zur Vernunft bringen und handelte dabei wahrscheinlich im Sinne des besorgten Mozartvaters Leopold. Was man kaum weiß, ist die Tatsache, daß Mozart 1763 in einer aus Salzburg stammenden Gräfin Arco (verehelichte von Eyck) „die liebenswürdigste Gastgeberin“ traf und daß er auf seinen Reisen nach Italien bei den mit den Arcos durch Heirat verwandtschaftlich verbundenen Pallavi- cinis seine besten Gönner fand. Über die Rolle der Arcos bei der Vertreibung der Tänzerin Lola Montez aus München ist unter dem Kapitel „Bayerns letzte Kurfürstin“ nachzulesen.
Das Zwischenspiel der Pallavicini 1848 übergab Graf Max von Arco seine Patri- monalgerichtsbarkeit und das Gerichtspersonal an den Staat. Im Dezember 1850 veräußerte Max von Arco den ganzen Zinneberg’schen Besitz an den Markgrafen Fabio von Pallavicini. Der Bruder von Graf Max war damals schon 18 Jahre lang mit einer Markgräfin Pallavicini verheiratet.
Von Fabio Pallavicini hat uns einzig Lehrer Dunkes Genaueres überliefert; er schreibt 1860: „P. erkaufte auch den Mairhof in Georgenberg, vergrößerte so die Ökonomie als außerordentlicher ökonomiefreund. Selten ist der Besuch dieses guten Herrn, und kömmt er, so ist sein erster Gang in den Viehstall, der mit außerordentlichen Kühen edelster Race angefüllt ist, wogegen ihn die herrliche Orangerie mit Gartenanlagen wenig zu interessieren scheinen“.
S. 73
Die Barone von Scanzoni u. Büssing 1868 erwirbt Baron Albert von Scanzoni — Lichtenfels Zinneberg. Unter ihm wird das Schloß mit seiner Brauerei und der Schießstätte zum Mittelpunkt eines volksnahen gesellschaftlichen Lebens. Gemeinnützigen Unternehmen wie dem Bahnbau Grafing-Glonn und frohen Festen leiht er seine Hilfe. 1898 verkauft er den gesamten Besitz an den Baron Adolf Büssing-Orville. Dieser kaufte Hof um Hof und zahlte soviel, daß manche Bauern mit ihren Katasterauszügen anbietend ins Schloß kamen. Die Brauerei wurde nach Egmating verlegt und in Sonnenhausen ein prächtiges Gestüt erbaut. Von früheren Kavalleristen wurden die spiegelblanken Fliesen und die rassigen Hunterjagdpferde gepflegt. (Wir selber gingen damals noch ins hölzerne Häusl mit ausgeschnittenem Lichtherz, wenn wir eine Notdurft hatten.) Angehörige sämtlicher berittener Formationen des bayerischen Heeres kamen jährlich zu den großen Jagden. Das starke Feld der flinken Pferde und ihrer Reiter im roten Rock war des Jahres größtes Schauspiel. In Hermannsdorf wurde dem Administrator ein schloßähnliches Haus erbaut. Die Geh- und Reitwege des Schlosses wurden Jahr für Jahr mit rotleuchtendem Mainsand bestreut. Büssing wollte mit dem alten, dem Königshaus verbundenen Adel gleichziehen. Der Reichtum erlaubte ihm viel: Fern von Zinneberg rauchten Fabrikschlote, und Schiffe fuhren übers Meer.
Mit der Ehe hatte Büssing wenig Glück. Seine erste Frau ging mit einem Offizier fort. Ein Austragsvater von Glonn traf damals auf der Straße die Mutter des Barons. „Da trat er zu der alten, äußerst eleganten und würdigen Dame, die als Norddeutsche kein Wort von ihm verstand und sprach sie an: „Wos ist dennert iatz dös? . . . Heart ma oiwei, Frau Baronin, daß dei Suh mit seim Wei net recht auskimmt . . .; noo . . noo-wead si scho wiedar richtn — harn sie a diawei oa z’keit“ (Zitiert aus den Glonner Geschichten und Dialektproben, die mein Bruder Sepp einmal in der „Münchner Zeitung“ veröffentlichte.) – Seine zweite Ehe mit der Generalstochter von Bothmer wurde geschieden. Gemeinsam hatte man das Ehepaar nur bei den Ausfahrten zur Jagd gesehen. So soll einmal ein Postbote einem neugierigen Sommerfrischler auf eine Frage die Anwort gegeben haben: „Der Baron und die Baronin leben getrennt; bloß jagern tean s‘ mitanand“. Im übrigen half Büssing freigebig allen Glonner Institutionen und Vereinen. Bei den vielen Theaterabenden war er mit seinem goldenen Zwanzigmarkstück der willkommenste Besucher. An Weihnachten wurden wir auf dem Schloß beschert und mit der grundnatürlichen unbefangenen Schlosser-Resl mußte er, ob er wollte oder nicht, die schönsten Schwünge auf dem Eis des Schloßweihers drehen.
S. 74
Die guten Hirtinnen
Nach 1918 zerstob ihm aller Schloßherrentraum. Er wohnte zeitweise in 2 Zimmern des Postgasthauses in Glonn (dessen Eigentümer er natürlich auch war). Baron Büssing starb 1948 im Alter von 85 Jahren in der Schweiz. Ein zwanzigjähriger Rückentwicklungsprozeß setzte ein. In Hermannsdorf und Georgenberg zogen hervorragende Landwirte als neue Besitzer ein: Die Familien Senkenberg und Korbmann. Zinneberg mit Sonnenhausen und Altenburg kaufte der Orden von der Liebe des Guten Hirten. An Schönheit und Zweckmäßigkeit der Gebäude und an liebenswürdiger erzieherischer Ausrichtung hat das Mädchenheim Zinneberg in den letzten 20 Jahren sehr viel gewonnen und sich in der ganzen Gegend Ansehen und Zuneigung erworben.
Als im März 1938 die meisten rüstigen Männer bei der „Österreichgaudi“ — so nannte man hier den überwiegend mit Mißbehagen empfundenen Einmarsch Hitlers in Österreich (den grimmigsten Spruch dagegen hat „der Marin“ getan, er war so kräftig, daß man ihn hier schlecht niederschreiben kann!) – eingerückt waren, brannte ein Großteil des Schlosses nieder. Die Ursache wurde nie aufgedeckt. Der älteste Flügel der Anlage wurde beim Wiederaufbau seiner ursprünglichen gotischen Gestalt wieder angenähert. 1973 erhielt Zinneberg eine kraftvolle, moderne und formschöne Schloßkapelle, sie wurde das Abschiedsgeschenk der bald danach nach Baden-Baden gerufenen baufreudigen und bautüchtigen Oberin M. Gabriele Graf. Als deren sehr liebe, sehr alt und zerbrechlich gewordene Vorgängerin auf Zinneberg im Friedhof des Parks bestattet worden war, standen junge koreanische Schwestern lächelnd am offenen Grab. Eine neue Zeit.
 Frühlingssonne am Schloss, 1974
Frühlingssonne am Schloss, 1974
S. 75
Maria Leopoldine —
Retterin Bayerns, Schloßherrin auf Zinneberg
Unter den Schloßherrinnen von Zinneberg war keine ranghöher als jene letzte baierische Kurfürstin Maria Leopoldine, die 1827 das Schloß erwarb. Keine aber hat auch ein vielfarbigeres Leben durchlebt und keine so einen tragischen Tod erlitten wie sie. Und keine hat denn baierischen Land und Volk einen so großen und bleibenden Dienst erwiesen als sie. Ihr Vater war ein Sohn von Maria Theresia, der großen Frauengestalt auf einem Kaiserthron. Am 10. 12. 1777 wird Leopoldine dem Herzog der Toskana in Mailand geboren. Eine ihrer Schwestern wird die Frau Kaiser Franz II. Als Leopoldine 15 Jahre alt ist, erfährt sie, daß man ihre Tante Antoniette, die Königin Frankreichs, auf dem Schaffott, diesem „Altar“ der französischen Revolution, hingerichtet hat.
Ein Zufall wollte es, daß gerade in den Tagen der Geburt Leopoldines Karl Theodor, ihr späterer Gemahl, durch Erbfolge Kurfürst von Baiern wurde. Er war ein Pfälzer, leutselig (später mißtrauisch), leichtlebig, an großer Politik uninteressiert, den schönen Künsten und den Frauen zugewandt. In der Pfalz hatte man ihm sein lockeres Leben nicht verübelt. In seiner Ehe kinderlos, sorgte er durchaus väterlich gesinnt für seine unehlichen Kinder. Als seine Gattin 1794 stirbt, hoffte er in einer neuen Ehe einen Thronerben zu bekommen. Ohne einen solchen würden ja seine Vettern, die Herzoge von Zweibrücken, die Herren von Kurbaiern werden. Durch eine Ehe Karl Theodors mit Leopoldine, der Nichte des Kaisers, hoffte Österreich, Bayern an sich zu binden und es womöglich zu beerben.
Dem siebzigjährigen Karl Theodor ist die Erzherzogin Leopoldine mit ihren 17 Jahren „die Angenehmste und Anständigste“. „Sehnlichst und mit unbeschreiblicher Ungeduld“ erwartet er Leopoldines Bescheid. Sie wehrt sich, beugt sich dann aber dem dynastischen Zwange und weil sie, angeblich durch einen Geburtsfehler, einen kleinen Hüftschaden hatte, gibt sie ihr Jawort. Als sie ihres Werbers Bild gezeigt bekommt, sagt sie: „Gottlob, daß er schon so alt ist.“
In Innsbruck wurde im Februar 1795 die Vermählung gefeiert. München empfing sie sehr festlich. Die junge Kurfürstin hatte nach dem Urteil einer Zeitgenossin „sehr viel Geist und konnte sehr liebenswürdig sein“. Aber die Ehe ging nicht gut. Leopoldine ließ sich immer weniger sagen. Ihr Gemahl meinte bald: „Sie hat demokratische Grundsätze . . . und würde mich am liebsten tot sehen“. Einige am Hof fanden sie ausgelassen. Aber die Münchner Leute mochten sie. Dem österreichischen Gesandten hätte sie gerne die Augen ausgekratzt, „daß er diese Heirat gemacht hatte“. Sie erklärte offen, daß die ärmste und einfachste Frau glücklicher wäre als sie.
Karl Theodor hätte sie am liebsten auch wieder fortgeschickt. Das aber ging aus religiösen und politischen Gründen nicht. Dagegen dachte er das ihm nie recht liebgewordene Altbaiern mit Österreich gegen dessen Niederlande am Rhein zu vertauschen. Die junge Kurfürstin, obwohl Habsburgerin, versuchte Baiern zu retten. Als Spannung und Mißtrauen unerträglieh wurden, traf Karl Theodor ein Schlaganfall. Nun handelte Leopoldine.
S. 76
Es war im Februar 1795. Sie beließ die österreichischen Truppen im Ungewissen, damit diese nicht in München einrückten. Sie verweigerte dem österreichischen Gesandten den Zutritt zum Krankenlager. Sie wandte sich „im wichtigsten Augenblick des Lebens“ an den nachfolgenden Kurfürsten, an Max Joseph in Zweibrücken: „Ich bin Ihre Untertanin. Ich erwarte Sie mit Ungeduld. Ich werde mich nach Ihren Befehlen richten.“
Nach einigen Tagen stirbt Karl Theodor, Münchens Glocken läuten, aber München trauert nicht, „die ganze Stadt fängt endlich an, frei zu atmen“. Max Joseph, der spätere König, behandelte Leopoldine, in dankbarer Erinnerung ihrer Verdienste um Bayern, mit großem Respekt. Ludwig I. bemerkt noch 1845 in einem Trinkspruch, daß es Leopoldine zu verdanken wäre, daß nicht die Habsburger sondern die Wittelsbacher in Bayern herrschten. Übrigens hatte Leopoldine beim Tode Karl Theodors verschwiegen, daß sie schwanger war, die Österreicher hätten zu gern das zu erwartende Kind als eines von Karl Theodor ausgegeben. Für diesen Betrug war sich Leopoldine zu gut. Nach Gerüchten soll der Graf Tauffkirchen oder der Hofkapellmeister Egg Vater dieses Kindes gewesen sein. Jedenfalls, Leopoldine war nun mit 22 Jahren die Churfürstin-Witwe. Dieser Titel blieb ihr auch nach der nicht als ebenbürtig geltenden Ehe mit dem Grafen Arco zeit ihres Lebens erhalten.
Am 14. 11. 1804 vermählt sich Leopoldine mit Ludwig Graf von Arco, der den Titel eines Obersthofmeisters erhält. Die Eheschließung wurde durch Max Joseph gegenüber Kaiser Franz II. überzeugend gerechtfertigt: „Der Adel der Familie Arco und das untadelige Wesen des Grafen sind allbekannt, und ich möchte mich meinerseits nicht der Ausführung eines Planes widersetzen, der . . . nichts Ungehöriges mit sich bringen wird und an dem das ganze Glück der Churfürstin zu hängen scheint.“ Ihre Residenz wurde die Maxburg, Lieblingsaufenthalt aber das Schloß Steppberg bei Neuburg, das sie schon 1802 erworben hatte und dann durch ein Dutzend Jahre hindurch ergänzte und erneuerte.
Nach dem Erwerb von Zinneberg (1827) erbaute sie das jetzige Schloß. Nur der westliche alte Burgflügel blieb erhalten. 1836 wurden das Glashaus und die Gartenanlagen erstellt. Wer ihr Architekt für den Schloßbau war, ist nicht bekannt. Man vermutet, der Romantiker Friedrich von Gärtner, der in München für Ludwig I. die Feldherrnhalle, die Staatsbibliothek, das Siegestor und die Ludwigskirche schuf. Leopoldine war in ihrer Art ein Finanzgenie: so ließ sich auch der König von ihr in Geldsachen beraten. Sie hatte Verbindung mit den Brüdern Rothschild: sie arbeitete auf Messen, erwarb unter einem Decknamen eine Münchner Han- delsgerechtsamkeit, je eine Brauerei in Freising und Haag und die in ganz Österreich bekannte Brauerei Kaltenhausen bei Salzburg.
In den gefährlichen Jahren vor 1848 schreibt sie dem König: „Sei standhaft und suche Schutz in Deinem Volk; es wird Dich nicht verlassen.“
S. 77
S. 79
 Erzherzogin Maria Leopoldine von Modena-Este, Kurfürstin- Witwe von Bayern (1776-1848)
Erzherzogin Maria Leopoldine von Modena-Este, Kurfürstin- Witwe von Bayern (1776-1848)
 Graf Ludwig von Arco, zweiter Gemahl Maria Leopoldines (1773-1854)
Graf Ludwig von Arco, zweiter Gemahl Maria Leopoldines (1773-1854)
Bei den Bällen und Empfängen hielt sie auf Hofetikette. Aber der Dichter von Platen, damals Hofpage, rühmt ihr zur Ungezwungenheit geneigstes Gemüt. „Sie wollte nicht besser und nicht anders erscheinen, als sie war und verbarg auch ihre Fehler nicht.“ Lehrer Dunkes schreibt in seinen Aufzeichnungen, daß „die hohe Frau“ Zinneberg bald ihrem Sohne überließ. Ihre Söhne waren, wie alle Arcos, scharfe Gegner der Lola Montez, weil sie sahen, wie gefährlich diese spanische Tänzerin dem Throne wurde. Arco-Valley versprach den Armen Münchens 5000 Gulden, wenn die Lola verschwunden wäre; er hielt sein Versprechen.
S. 80
Graf Max Arco-Zinneberg, Leopoldines 2. Sohn, hat aus dem Haus der vertriebenen Tänzerin eine Zigarettenspitze als Andenken an die gelungene Vertreibung aufbewahrt, war also wahrscheinlich an dem Sturm beteiligt und es ist durchaus möglich, daß unter der Arco’schen Armenspende auch Zinneberger Gold-Gulden mitklangen.
Am 23. 6. 1848 trat Maria Leopoldine eine Geschäfts- und Verwandten reise nach Österreich an. Sie wollte ihren Bruder in Gmund besuchen und weiter nach Wien fahren. Die in vielen Büchern und Schriften verbreiteten Darstellungen, die Churfürstin-Witwe hätte Steuern kassiert oder eine Wallfahrt nach Altötting geplant, haben sich als falsch erwiesen. Aufzeichnungen aus dem Leben ihres Bruders, des Erzherzogs Maximilian, in die Einblick zu nehmen ich der Gräfin Maria Theresia Arco-Zinneberg auf Schloß Moos verdanke, bringt die Tatsachen ihrer letzten Fahrt.
Frühmorgens empfing sie in München die Sakramente und wohnte der Messe bei. Sie stieg mit ihrer Kammerfrau, die schon 50 Jahre bei ihr im Dienst war, in den Wagen. In der Gegend von Haag soll sie mit ihrer Kammerfrau den Platz auf dem Wagen gewechselt haben. Am steilen Achaziberg bei Wasserburg kam bergabwärts ein schwer beladenes Fuhrwerk entgegen, das Salz und vielleicht auch Holz geladen hatte. Die Bremsen brachen, es kam zu einem fürchterlichen Zusammenstoß. Der Wagen Leopoldines wurde umgeworfen. Eine eiserne Kasette war wohl auf dem Wagen (heute noch in Besitz der Arcos), enthielt dann aber nur Wertpapiere. Die Kurfürstin stand nach dem Sturz wieder auf und sagte, daß ihr nichts fehle. Nach wenigen Schritten brach sie zusammen. Sie starb in ihrem 72. Lebensjahr.
Nahe der Unglücksstelle befand sich das Le- prosenhaus. Dort soll sich ein Wundarzt noch um die Verunglückte bemüht haben. Nach dem Obduktionsbefund führte ein Leberriß zum raschen Tod. Die Leiche wurde im Rathaussaal aufgebahrt. Das Volk der Stadt und Mitglieder der kgl. und der gräfl. Familie geleiteten die Tote aus der Stadt.
Als Enkelin einer großen Kaiserin war sie einst in der Wiege gelegen. Als Kurfürstin, selber unglücklich, war sie ein Glück für Bayern. Als Gattin befreit, wurde sie eine sorgende liebende Mutter. Erfolgreich war sie in ihren rastlosen Unternehmungen. Zuletzt aber ging die Fahrt quer durchs bayerische Land hin zur Gruftkapelle in Steppberg. Das Rauschen des nahen Stroms sang ihr das Grablied.
Sie hinterließ ein Vermögen von 4 Millionen Gulden. Eine beträchtliche Summe wurde für wohltätige Zwecke verwendet. — An der Unglücksstelle in Wasserburg steht heute noch der Gedenkstein mit dem Wappen ihrer österreichischen Herkunft und ihrer bayerischen Würde.
S. 81
„Ein gottseliges Land” – Fahrt zu den Dörfern
Wo die quellfrischen Wasser der Glonn gegen Süden wandern und der Wendelstein, in Silber und Blau gerüstet, als Wächter ins Tal sieht, dort ist der Münchner Südosten erstmals in seine volle Anmut aufgebrochen. Weit wogt das Auf und Ab der Hügelund Wälder; Blumen in Fülle schütten ihre Farben von den Fenstern des Marktes und von den Altanen der Dörfer und der Wiesenwind singt um helle Kirchtürme und bauernfürstliche Einödhöfe. Als Glanzlichter aber hat der Herrgott in die pastorale Landschaft noch eine Handvoll entzückender Seen gesetzt. Die Dörfer rundum haben vielleicht weniger Geschichte als der Markt aufzuweisen, aber kaum weniger Kunst. Das Leben dort lebt sich noch nachbarschaftlicher; die Sprache ist dem Ursprung noch näher, reicher und farbiger in der Mundart; kurzum die Heimat dort ist noch mehr die alte geblieben. Und wie Glonn nichts wäre ohne die klaren Wasser, die es durchfließen, so arm wäre es auch, wenn nicht heimlich der Atem der Ursprünglichkeit Tag um Tag von den Höfen auf den Höhen, von den Fluren der Dörfer unsere Straßen durchlüftete; denn München ist nahe und die große Stadt irrlichtert auch zu uns herein, der Fernseher blendet und so mancher der Wegweiser ist auf Irrtum gestellt.
Aber droben und draußen da ist noch die große Natur, da sind noch, in Sonne und Schatten, die schönen Hallen des Hochwaldes und die dunklen Dickichte in den Niedergehö zen. Da geht der Blick von der Zugspitze bis zu den anmutigen Bergen jenseits von Salzburg und wenn der Fallwind einfällt, einst Sunnwind und Etschwind genannt, dann schimmert der uralte Gletscher, der unser Land einst geformt, von seiner letzten Feste herüber, vom Pyramidenthron des Großvenedigers. Um uns aber lebt das liebe Land der Hügel und wärmt sich an seiner Lieblichkeit und seiner Tauglichkeit für den verlorenen Menschen, für den eine solche Heimat immer noch etwas wunderbar Übriggebliebenes ist: ein Nachgeschmack des Paradieses und eine große Hoffnung.
Wenn wir nun von Glonn hinauf und hinaus zu seinen Dörfern wallfahren, so wird man es an schönen Tagen und bei aufgeräumtem Herzen gar nicht so übertrieben finden, daß jemand einmal schrieb, die Hügel und Täler bei Glonn wären ein gottseliges Land. Und wenn wir uns die vielen alten Kirchen aufschließen lassen, die in den Nachkriegsjahren zu ursprünglicher Schönheit wieder auferstanden sind, dann glauben wir dem altbaierischen Dichter Oskar Maria Graf, der da sagt, daß die Baiern weniger ein gottfürchtiges als vielmehr ein gottanhängliches Volk wären.
In der späten Gotik und im Ausklang des Barocks hat unser Stamm zu sich selber gefunden. Aus diesen beiden goldenen Zeitaltern baierischer Kunst haben sich treffliche Zeugnisse in unserer Heimat erhalten. In jenen Perioden war die Kunst noch Handwerk und das Handwerk war Kunst. Wir spüren es in den kleinen spätgotischen Dorfkirchen, unter den Gewölben in Haslach und Adling und vor den innigen Madonnen in Frauenreuth, in Kreuz und in Schlacht. Und mit welcher Liebe und Begeisterung haben die Baiern, und mit ihnen dann die Schwaben und die Mainfranken, den barocken Aufbruch von jenseits der Alpen angenommen und ins Eigenste umgesetzt!
S. 82
Kaum ist der „Krieg der dreißig Jahre“ vorbei, gefällt und gelingt es unsern Landsleuten, eine so fantasiereiche doppeltürmige und dreischiff- fige Kirche wie Weihenlinden an den Rand eines Dorfes zu bauen. Und am Ende der Zeit des großen „Bauwurmbs“ leistet sich das nahe Weyarn den elegantesten, sensibelsten, raffiniertesten bayerischen Bildschnitzer, den Ignaz Günther. Die Benediktiner von Rott am Inn holen sich mit ihm auch noch den großen Freskanten, den einstigen Bauernbuben und Ministranten vom Hohenpeißenberg, den Mathäus Günther, daß er den Rotter Himmel mit allem Glanz und aller Pracht in die neue Klosterkirche zaubere, die Altbaierns bedeutendster Barockmeister Johann Michael Fischer zu seinem letzten gloriosen Werk entworfen hatte.
Aber bescheiden wir uns! Da liegt ein Ort mitten im Holzland. Rundum inselt grünes Wiesenland und Ackererde, blau und schwer von Fruchtbarkeit, trägt und nährt das alte Dorf. Es ist SCHLACHT, ein gereuteter Kegel, im 14. Jh. „Slot“ genannt, klanglich verwandt mit dem mundartlichen Schlocht. Sauber sind Ort und Kirche gehalten, und etwas Gesundes glaubt man in die Nase zu bekommen, so wie früher, wenn an Samstagen die brozzelnden Schmalznudeln in die Straßen witterten. In der Kapelle wiegt die Madonna, nach 1500 geschnitzt, mit beiden Händen ihr liebliches Kind. Aber der Geiger Toni und die anderen Schlachter unserer Zeit ruhten nicht, bis nicht auch St. Martin, der Patron, die Decke der Kapelle schmückte. Man holte sich 1948 Prof. Oskar Martin-Amorbach, der in Würzburg die vom Krieg zerstörten vielen Fresken in den Kirchen malte. Tagsüber stand der Maler auf dem Schlachter Gerüst, abends klopfte er mit den Bauern die Karten auf den Tisch und beidesmal fühlte er sich überaus wohl.
S. 83
 St. Martin – Fresko von Oskar Martin-Amorbach im Kircherl zu Schlacht
St. Martin – Fresko von Oskar Martin-Amorbach im Kircherl zu Schlacht
Da reitet nun der Heilige als Mann der hohen Würde, der Zucht und der Gediegenheit auf seinem Schimmel, den Mantel mit dem Bettler teilend. Klar ist die gebirgige Landschaft; in Grün schimmert der Himmel und wunderschön klingen das Rot, das Orange und Braun der Gewandung dazu. Ein Vesperbild des gleichen Malers setzt die Schmerzensmutter und die Dornenkrone über die Namen der 10 Gefallenen des letzten Krieges, 29 Jahre war der älteste, 18 der jüngste, 3 sind allein schon vom Berchert und 2 vom Greil. Und die Schlachter sind zu loben, daß sie die alten Hofnamen für alle Zeiten bei ihren Gefallenen festgehalten haben. Nur einen Blick noch auf die Rokokowangen des Gestühls und auf die schöne Renaissance-Emporenwand!
Es ist April! Die Berge stehen blau über den Wipfeln und später Schneewind flutet kühl herüber. Über den Fichtenwipfeln schaut die Turmkuppel von Kreuz: Einsam steht der Madonna Haus /auf jenem stanft-geschwungenen Schnee- u. Wiesenhügel / der in den Kammern seiner Erde birgt, / was einst im Dorf gelebt,/ was übers Feld ging, / und melkend bei den Kühen saß im Stall,/was da schlief in heißen Bauernbetten / und was hinaussah übern Wald zu jenen blauen, überblauen Bergen.
Und nun in KREUZ:*) Strenge Raumschönheit unter romanischen Tuffquadern mit Kielbogenfenstern aus späterer Zeit. Auf dem entzückenden Altar die Gottesmutter mit dem nackten Kindlein auf dem Schoß, das unbefangen sein Geschlecht auch zeigen darf. Spätgotisch das Werk, aber im reichen Faltenwurf ist schon das Kommende vorausgeahnt; der Barock lag ja den Baiern von jeher im Blut. 80 m über dem Glonntal liegt die Kreuzer Höhe. Bis 1723 waren dort die Jahrmärkte gehalten worden und ein Kreuz mag einst das Marktzeichen gewesen sein. Die alten Hausnamen gelten noch (L. Thoma nennt sie Kleinode), die immer schon ein Stück vom Bauernadel ausmachten.
*) Im Altar landen sich Urkunde und bischöfliches Sieqel der Weihe von 1268.
S. 84
S. 85
 Der Quellgrund der Glonn: Das Mühltal
Der Quellgrund der Glonn: Das Mühltal
Da ist der „Schneeberger“, der sich einst Grasberger schrieb und heut Abinger. Und da ist sein kleinerer Nachbar gewesen, der sagen konnte: „Peter hoaß i, Wimmer schreib i mi und der Mesner bin i, und a Politiker bin i aa!“ Übrigens heißen die Kreuzer, Reinstorfer, Balkhamer, Kastenseeoner, Steinhäuser, die vom Mühltal, von Ursprung und Adling zusammen „die Grea- winkler“, vielleicht, weil dort oben im Auswärts und im späten Herbst das Grün der Wiesen und Weiden besonders leuchtend erscheint, aber wahrscheinlicher, weil all diese Siedlungen den gründunklen Wald zum Hintergründe haben.
S. 86
Reinstorf wurde erst 1927 in das so nahe Glonn eingepfarrt. – Balkham, im 14. Jh. Palchaim und Polchaim, hat innere Beständig keit für sich. Alle heutigen Hausnamen finden sich schon im Salbuch um 1660.
Den STEINHÄUSERN hat man in der Säkularisation die Nikolauskirche genommen. Wie ein Schiff auf hoher Welle steht das Örtl überm glucksenden Quellengarten des Glonnursprungs.
S. 87
Der dichtende Hauser von Haus muß das einmal ähnlich gesehen haben, weil er in seiner Glonner Schöpfung die Arche Noes dort oben landen läßt. Wer möchte unten im Mühlthal die Quellen zählen, wer sagen, wo der Bach beginnt? Keine 500 m und schon hat das Wasser seine drei Mühlen und die Sägen getrieben. Der „Stoamüller“ liegt am kiesigen Hang gegen Steinhausen hinauf. Um 1180 hatten sie da droben den Ortsadel „de Stein- hus“, das ist „zum steinernen Haus“, zur kleinen Burg. Kaum senkt sich der Talgrund, kommt die Kothmühle und reicht sogleich wieder der Stegmühle das Wasser weiter. Die alte Kothmühle hatte sich an den Bach geduckt. Wenn ich bei der Kothmüllerin einkehrte — sie war eine selten-gute Haut -, sah ich draußen fast in der Höhe des Fensterbretts den Bach vorbeilaufen und ich konnte die Hände ins Wasser tauchen, wenn ich sie kühlen wollte. Und obwohl uns die Münchner das Wasser abgegraben haben, so könnte man im Mühltahl immer noch in einer einzigen Sekunde 5 alte Hektoliterbanzen füllen. Die steilen Hänge hinauf ziehen die Buchen und wer denkt schon daran, daß sich vor 2500 Jahren die Buche im Oberland erst angesiedelt hat. Und lebte droben an der Straße wie damals im Barock beim „Maler am Berg“ noch ein malender Böhamb, der bräuchte nicht weit, um Modelle zu finden für seine Madonnen, seine Kathrinen und Barbaras, welche die Leitzachtaler mehr als die Glonntaler von ihm an die Hauswände malen ließen; in der Nachbarschaft gäb es genug. Aber vielleicht hätte ich das gar nicht verraten sollen; ich sag es ja auch nicht gern, daß es im Mühlthal immer die schönsten Frühlingsblumen gibt: / Druntn am Grobn, es ist dort noß —, / do konnst dös erste Bussal hobm / . . . vom Schmoizblemi im Gros. / Und drobn am Hang, wo d‘ Sunn so brennt, / — i bi dort z’Haus —, / do hängan kloane Schuastanagal / de erstn blaun Tüachal aus. / — Der Kuckuck ruft und die Wildtaube gurrt und die Widder trommeln wie Spechte, nur etwas dunkler und gleichmäßiger, den Takt dazu. Bei dem Widder am Brückerl ist ein kleines Naturwunder zu sehen; innerhalb von 60 Jahren hat das so kalkreiche Überwasser einen mächtigen Tuffkropf ausgebildet. Und die Glonn war es, die einst die mächtigen Tuffbänke schuf, auf denen Glonn sich niederließ. Übrigens soll der Fluß früher durch den „Seestall“ beim Bahnhofgelände, gleich südöstlich zwischen Huberwirt und Keßlerhaus seinen Lauf genommen haben. Der heutige Weg des Baches zur Wasl- und Christimühle zeigt deutlich, daß hier Menschenhand am Werke war.
Zu den Greawinklern zählen auch die KASTEN- SEEONER. Vor 60 Jahren war im Sommer am See nur ein Badehüttel zu finden, ferner ein Veteran von einem grobschlächtigen Kahn, etliche Schulbuben und ein paar Sommerfrischler. Auf einem kleinen Sprungbrett liefen wir den Wolken und Winden entgegen, sprangen dem blauen Himmel in die Arme, plumpsten ins Nasse, gurgelten wieder herauf und schüttelten uns das Wasser aus den Haaren und den Augen. Wir lachten, weil wir zu kurz gesprungen waren und den Himmel nicht erreicht hatten.
S. 88
1915 schlug bei einem Nachmittagsgewitter ein doppelfeueriger Blitz beim Franzen ein (die Kastenseeoner Sängerinnen stammen aus diesem Hof!). Mit uns Buben war auch die Lena Christ am Badestrand gelegen.
Wir eilten alle zur Brandstätte. Während „der Schwabinger“ Peter Jerusalem mit der Leiter zum Obergeschoß des Wohnhauses stieg und die Fenster aushing, wußte die Lena Richtigeres zu tun. Sie holte die Schmarrnpfanne vom Herd heraus und kümmerte sich dann rührend um die zu Tod erschrockene alte Austragsmutter.
S. 89
ADLING hält auf nachbarschaftliche Eintracht. Es feiert sein eigenes sommerliches Dorffest und dem idyllisch gelegenen Kirchlein gehört die gemeinsame Liebe. Es ist außen und innen geschmückt wie eine Braut. Störende Elemente von früher wie die eingebaute Lourdesgrotte, die dem Chronisten Niedermaier 1909 schon mißfiel, wurden beseitigt. Dafür hat Xaver Scheidwimmer sen., ein großer Mann im deutschen Kunsthandel, der mit einer Adlingerin verheiratet ist, ein sehr feines Gemälde gestiftet, eine Mariä Verkündigung: Die Madonna, eine überaus graziöse aber fromme Rokokodame, empfängt, innig hingegeben, die Engelsbotschaft. Reiches Netzgewölbe überspannt den Chor. Vom Altar her predigt mit ausladender Geste der hl. Lampert. Er läßt vermuten, daß eine Verbindung mit Kloster Seeon bestand. Ein Ortsadel ist für 1120 nachgewiesen.
DOBLBERG, urkundlich nur 74 Jahre jünger als Glonn, gibt einen wunderschönen Waldweg zum Steinsee frei und vorher den anmutigsten Blick hin nach Glonn. Wie ein breiter grüner Fluß zieht im Frühsommer das Tal gegen Süden. Niedere Hügel und sanfte Höhenzüge ufern es ein. Ein halbes Jahr später brennen in der Filze die goldenen Fackeln des Herbstes. Und wenn Du im März durch den Hochwald zum stillen See kommst, der hunderttausend- mal älter ist als wir sind, dann tut er eben wieder einmal seine noch winterschlaftrunkenen Augen auf. — Das nahe ALTENBURG, wie Tuntenhausen und Weihenlinden als Wallfahrtsziel zu uns gehörend, kennt keinen Winterschlaf mehr, seit es seit etlichen Jahren dem Ruin entrissen, immer froher und festlicher wird. Gewiß nehmen andere nahe Wallfahrtsorte dem künstlerischen Wert nach einen höheren Rang ein, aber keine dieser größeren Kirchen ist so heiter und so anheimelnd wie die kleine Muttergotteskammer auf dem Altenburger Hügel. Reich ist der Stuck und so fröhlich, daß man in seinem Laubwerk, seinen Ranken, Früchten und Blumen die welschen Anregungen gar nicht so zur Kenntnis nimmt. Die Madonna, noch aus der gotischen alten Kapelle, auf dem Halbmond stehend, hält Dir mit beiden Händen ihr Kind entgegen. Dem Kind gar innig hingegeben, vergißt sie es wohl gerne, daß einst ihr Heiligtum hier eine blühende Wallfahrt war, die zu jenen 13 bedeutendsten Altbaierns gehörte, die mit ihren Landschaften von Joachim Beich in großen Bildern für den Münchner Bürgersaal von 1710 — 1745 gemalt worden sind. Schräg gegenüber den geschickt in einer Nische eingeborgenen alten und neuen Votivtafeln (dankbar zu lesen: „…aus Deiner Hand der Friede kam,/Schönste aller Frauen“) hängt das reizendste aller Osterbilder der Heimat: Christus begegnet als Gärtner Maria Magdalena. Das Kunstwerk verdient auch deshalb unsere Aufmerksamkeit, da Reliefs aus dem 15. Jh. in der ganzen Kunstlandschaft um München sehr selten sind. Die Kirche ist von Moosach aus auf seinem Wald- und Wiesenhügel gar lieblich anzusehen und man denkt kaum daran, daß hier einst die alte Burg stand (die „neue“ ist Falkenberg), nur der steile Abfall im Norden zur romantischen Nagelfluhschlucht der Moosach erleichtert der Fantasie sich auf ihre Weise zu erinnern.
S. 90
 Das Adlinger Dörferl über der Filze
Das Adlinger Dörferl über der Filze
MOOSACH ist mit gebührender Ehrfurcht zu grüßen, es könnte ja heuer mit Glonn Hand in Hand jubilieren. Noch dazu ist nach dem urkundlichen Nachweis des Flusses von 774 nur 16 Jahre später auch die Siedlung schon nachweisbar.
S. 91
WILDENHOLZEN, durch Jahrhunderte mit Zinneberg geschlechterverschwi- stert, wendet den inneren Ring der Glonner Landschaft von Norden gegen Osten hin. Die Burg ist versunken, die Kapelle blieb erhalten, und da und dort winkelt noch das alte Gemäuer der Wehranlage. Überm schlanken Ro- kokoaltärchen der Kapelle blieb noch jener Raum erhalten, welcher der Burgherrschaft hinter zwei Fenstergittern die verschwiegene Teilnahme an der Morgenmesse erlaubte. Afra, die letzte Herrin, die liebevolle und tränenreiche, ist Dir nahe. Der hl. Nikolaus, wohl sicher eine liebenswürdige Figur aus der Hand von Joseph Götsch, mag der großen Sorgerin für die Armen nachts die goldenen Äpfel reichen.
Ein einsamer Waldweg führt hinüber nach SONNENHAUSEN. Kein Mensch begegnet Dir. Auch nicht an Sonntagen. Die lichthungrigen Münchner säumen nur die Ränder der Wälder. „Sonderhus“, das Haus gegen Süden gelegen, so hieß Sonnenhausen einst. Ich sehe aber diesmal lieber vom verfallenden Pavillon über Wald und Wälder, über diese ruhigste Landschaft der Heimat, gegen Norden. Der Schloßherr hat die offene schöne Kanzel einst erbauen lassen, daß die Gäste in der Dämmerung das Äsen der Rehe schauen und im Zauberlicht der Fackeln und der Lampions sich nächtlichen Schwärmereien hingeben konnten. 1803 ließ Graf Fugger die baufällig werdende Kirche abbrechen, napoleonische Truppen hatten sie halb zerstört. Bis 1800 findet sich der Familienname „Sonnenhauser“ in den Glonner Taufbüchern.
WESTERNDORF taucht 1035 urkundlich auf und versteht es gut, sich mit seinen Obstangern von der lauten Straße abzusetzen. Und dem braven Anderlvater mag es in der Ewigkeit drüben recht sein, daß seine Waldkapelle, die er bis zum Ende seiner Tage rührend umsorgte, nach der Verlagerung der Straße ein stilles Abseits gefunden hat.
Von den alten Eichen bei der Schießstätte (einst war dies der Ort Spitzentränk) und vom Dach des Wasserhügels westlich HERMANNSDORF geht der Blick zu den Chiemgauer und Berchtesgadener Bergen. Der gegenüberliegende hohe Kegel über GEORGENBERG (1269 mons sancti Georii) mag einst eine heidnische Kultstätte gewesen sein, die schon früh durch ein Kirchlein für den „frummen Reitersmann“ St. Georg abgelöst worden sein dürfte.
WETTERLING, einst nur vom Schmied, vom Wagner und vom Förster bewohnt, der auch des Barons Fasanen zu warten hatte, hat sich eine prächtig gelegene Mustersiedlung angegliedert, die an Aussichtsherrlichkeit alle ihre Schwestern im Tale übertrifft. Daß der große Theologe Romano Guardini in seinen Altersjahren dort oben oft lange meditierender Gast gewesen ist, haben wir kaum mitbekommen.
BERGANGER, auf den Pergamenten 10 Jahre älter als Glonn, hat gegen Südwesten eine der reizvollsten Feldkapellen Oberbayerns. Es ist „Die Schwedenkapelle“, errichtet zur Errettung im großen Krieg und während der Pestjahre.*)
*) Eine alte. Gott sei Dank immer wieder rechtzeitig erneuerte Tafel besagt, daß „Perchanger und deren Nachbarschaft zu Feindts und sterbs Zeiten präserviert worden“ und daß sie auch „vor der leidigen Nifection von 1635“ verschont blieben.
S. 92
Unmerklich und anmutig gehen die Nachklänge der gotischen Formensprache in die des frühen Barocks über. Der kleine Altar von 1666 ist leider einmal verkauft worden und ein schlauer Alemanne hat ihn, so hat es mir der Zehetmair mit Bedauern erzählt, bis Lörrach gegenüber von Basel gebracht. Der Altar hatte seine erste Demütigung bereits 1895 erfahren; er mußte nämlich in der Kirche in Berganger, in der er ursprünglich stand, der unleidigen Gotisierung weichen und kam damals in die Schwedenkapelle. Daher kommt es auch, daß in Berganger ein paar innig-schöne Figuren, St. Barbara und St. Jakob, die dem Meister von Ra- benden zugeschrieben werden, in engen schreinergotischen Gehäusen gefangen sind.
Die Heiligen von WEITERSKIRCHEN (mundartlich Wallischkirch) haben es da besser. Es gibt wenig Landkirchen, die so reich ausgestattet sind. In Gold auf Schwarz prunken Altäre der sogenannten Chiemseerenaissance. 1642waren die Schrecken des großen Krieges noch nicht vorbei, aber der Horizont war lichter geworden; da baute der Bauer seinen Hof wieder auf, er fand sich mit seinen Nachbarn zusammen, das Beyhartinger Kloster schickte seine Bauleute und alle zusammen schufen zu festlicher Dankbarkeit und als Zeichen gläubiger Daseinsfreude eine herrliche Kirche, die, seitab gelegen und später den vier Bauern gehörend, unversehrt bis zu uns heraufgekommen ist. Und wieder in einem Kriegsjahr, es war 1942, wurde das Gotteshaus durch einen der gewissenhaftesten Kirchenmaler jener Jahre, durch Georg Hilz, erneuert. Fehler der gutgemeinten Restauration von 1866, die weitgehend der Wundarzt Georg Maier von Glonn bezahlt hatte, verschwanden, und seitdem ist es nur die üble Mauerfeuchtigkeit, die den kostbaren Figuren immer wieder schadet. So wird demnächst eine gründliche Außenrestauration versucht werden.
S. 93
Wenn auch 1866 manche Fassung dem bloßen Geschmack einer kunstsicheren Zeit entsprach, so bleibt es doch das Verdienst des Wundarztes Maier, daß die Kirche und ihre Schätze in ihrer Grundsubstanz in Liebe und Ehrfurcht bewahrt worden sind. Da ist die mädchenhaftzierliche Madonna in der Pieta aus dem frühen 15. Jh., deren Schmerz wie ein stilles Lied ist. Da ist der spätgotische ritterlich-edle Florian. Da trägt Kaiser Sigismund Szepter und Reichsapfel und Krone und in den sorgenvollen Zügen die Last seines Amtes. Das muß damals ein vielverehrter Heiliger gewesen sein, begegnet er uns ja in Kirchen der Nachbarschaft in ähnlicher Gestalt. Da ist „Anna selbdritt“ sitzend in gesunder Fülle und mit der schöngewölbten mütterlichen Brust. In einer Büste gibt sich St. Augustinus weltmännisch vornehm und geistgeprägt. Engel und Putten beflügeln die geistliche Landschaft; die meisten noch der Renaissance zugehörig breiten sehr würdig ihre Flügel im Gleichmaße aus, während sich andere über der Gnadenmadonna als tanzende Engelbübchen hereingemacht haben und Dich in der Unbefangenheit des Rokokos mit lebhaften Gebärden fröhlich herbeiwinken. Die Tiefe des Gefühls unseres baierischen Stammes und die Kraft des Willens zur schöpferischen Vollendung sind in Weiterskirchen Bild geworden. Eine arme Zeit wollte sich eine reiche Kirche bauen. Mit Recht wurde 1742 mit großer Feierlichkeit das erste hundertjährige Jubiläum begangen. 1807 aber haben sich die Bauern die Kirche gekauft und sie so vor dem Abbruch gerettet; so standen die Bauern auch vor dem Altar auf eigenem Grund.
Jakobus, der Pilger von Weiterskirchen weist uns hinauf in seine Gemeinde, in des Herrgottes ureigenstes Land, in den BAIERER WINKL. Hoch oben hat man Jakobus eine der besten neubarocken Kirchen des Landes erbaut. Vom Ebersberger Aussichtsturm und vom Turm der Christkönigskirche in Rosenheim, von den Landstraßen innabwärts, vom Samerberg u. vor der Hochriß, vom Wendelstein, Breitenstein und vom Schwarzenberg, vom Irschenberg und vom unteren Mangfalltal aus: immer trifft das Auge die Baierer Kirche, einmal auffallend und selbstverständlich, dann wieder nach einigem Suchen mit dem guten Auge oder mit der Waffe des Feldstechers, sagend: Natürlich, ich bin es, hier ist Baiern, hier ist Baierland. Wie schön dann von der Kirche und ihrem Friedhof der Blick in die Ferne sein muß, kannst Du Dir denken. Hier ist gut sein, und so hat man hier Christus und seinen Heiligen ein königliches Gezelt gebaut und noch in Afrika weiß man davon, haben doch vor zwei Jahren zwei Togolesen einfach über Nacht gefunden, im Bairer Winkl ihre Primiz zu feiern, wäre das Allerschönste. Und weil in Baiern drinnen die Menschen noch Leut sind und die Schulkinder noch wendig, haben ein halber Tag und eine Nacht gereicht, das vom Himmel gefallene Fest fröhlich und farbig hinzustellen.
S. 94
Anton Niedermaier von Hohenbrunn hat 1923 in der Kirche die Fresken gemalt, ernst, reif, eindringlich, fromm, sein letztes Werk. An derWand der Empore aber jubelt die Musika am himmlischen Ort: Kinderengel spielen die Flöte, streichen die Baßgeige, schlagen das Schlagzeug und mächtig schallt das runde Horn heraus. Rechts im Bild steht die alte Kirche, von der heute nur mehr der alte Turm zu finden ist, dem einst die Zehtmeierin mit einem Opfer von 400 Mark das alte Leben rettete.
 Ausblick von Jakobsbaiern übers Glonntal nach Höhenrain
Ausblick von Jakobsbaiern übers Glonntal nach Höhenrain
S. 95
Die musizierenden Engel aber sind ein Sinnbild für Sing- und Musikantenbrauch im Baierer Winkl. Die Tradition hat in den letzten Jahren geradezu eine gesunde Auferstehung erfahren. Die Kinder in der Schule und beim advent- lichen Klöpfeln, die Dirndln und Burschen in den Stuben, die Musikanten vorm Wirtshaus und am offenen Grab und die Mannsbilder der Baierer Sänger auf der Alm, in der Mettennacht und in der Passion, sie singen und spielen, und ich bin gewiß, der Kiem Pauli hört zu. „Im Baierer Winkl do bin i dahoam, / i hob a Leder- hosn, trink mei Bier mit Foam / und im Fruah- jahr hob i an Schnurrbart aa, / ois wann i a glernter Jaager waa“. Und der Girg, der hoam- liche Poet vom Hauserhof, is für die da drinnen die gute Stimme des Gewissens: „Teats plattln, machts dö oitn Tanz, / san schöna wia de Negerpflanz“ . . ./ I sogs enk Leit, vo noh und fern, / habts fei enka Hoamat gern. / es is do ganz wos Bsunders dro, / wers nimmer hot, der woaß dös scho“.
„Ein wenig ästig wie das Holz ihrer Wälder, ein wenig rauh, biderb, spottlustig, witzig und schlau, aber ohne Hinterlist und Falsch“, so hat sie einmal mein Bruder Sepp geschildert, das ist 47 Jahre her, aber so sind sie noch heute die Baierer Winkler, und etwas haben sie inzwischen dazugewonnen: die augenklarsten Kinder weitum, und ihre schöne Schule liegt auf einer der allerschönsten Aussichtskanzeln Oberbayerns und diese Schule wird hoffentlich nie einem naiven Fortschrittsglauben zum Opfer fallen. Und wenn sich Baiern im Zuge der Gemeindereform mit Glonn verbinden wird, dann wissen wir, eine schönere und gesündere Braut können wir uns gar nicht wünschen. Das gibt dann einen Kammert- wagen, hoch auf mit altem kostbaren Gut und mit junger Kraft beladen.
Übern Klinglwirt hinunter ins Glonntal! Diesen „Chlingel zu Peuren“ gab es schon 1587. Droben liegt der alte Friedhof mit dem kirchenlosen Kirchenturm, an dessen Flanke am Fronleichnamstag 6 Böller standen; eine gewaltige Salve krachte übers Tal, sooft der Priester den Segen erteilte. Jenseits des Tales träumt das alte Höhenrainer Schloß; vielleicht denkt es noch an jenen seiner Herren, der als Florian Paumgartner 1536 wegen Bigamie zum Tode verurteilt wurde. Aber als er im Falkenturm zu München den Tod erwartete, gab man ihm noch Gelegenheit zur Flucht; in Ungarn erlosch dann der Brand seines liebestollen Herzens im Gift eines türkischen Pfeils. Von seinem HÖHENRAINER Schloß wär es noch ein Katzensprung zum idyllischen Kircherl überm Mang- falltal, wo auf einem Fresko ein zwergwüchsiger Teufel ausgetrieben und an die Kette gelegt wird, während darunter Joseph Götsch um 60 Gulden eine liebliche Rokokokanzel setzte. Einst stand neben der Kirche mit der chiemgauweiten Sicht noch ein 20 m hoher Aussichtsturm. Es gehörte zu den Enttäuschungen meiner Kindheit, als ich mit nach Kleinhöhenrain wandern durfte und mein Vater köstlichmundendes Bier und für mich eine Brotzeit bestellte, ich aber nicht mehr den Turm fand, dessen Besteigung meine Fantasie in lebhafteste Erwartung gesetzt hatte.
S. 96
Heute ist mir dafür das gotische Kircherl im nahen ELENDSKIRCHEN vor dem mit heilem Maiengrün durchsprenkelten Fichtenwald und in der Kirche der altbaierische Stukkaturenjubel um die schöne Madonna ein Fest für die Augen und Entschädigung genug. Ich wandere dann nach EUTENHAUSEN hinauf und genieße den schönsten aller heimatlichen Nordausblicke, unendlich sanft wogt das Land in einer duftigen Atmosphäre bis hin zum großen Forst und bis hin zu den Höhen und Höfen jenseits des Inns. Dörfer und Städte legen im Licht des Tages ihr Geschmeide in die Fenster der Landschaft. Drunten in LAUS locken das blaue Auge des Sees und die schattenmächtigen Bäume vor dem Dorfwirtshaus. Rundum steigen die Höhen empor, den Himmel herunterzuholen. Drinnen in der Tuffsteinkirche geht St. Martin friedlich mit der Lauser Gans, und St. Veit im Kessel, noch kaum dem Bubenalter entwachsen, läßt sich der himmlischen Glorie entgegenmartern.
Und nun mit dem kleinen Bach durch lauter Wiesen- und Schilfanmut, zwischen Hügeln und grünmoosigen Wäldern gegen Norden. Wir wandern durch ein Paradies der Pflanzen und der Tiere, und in Sommerzeiten blühen die weißen Wunder der Seerose aus den Tümpeln in einer sonst hier nirgends anzutreffenden Fülle. Durch eine seitliche Senke grüßt von halb oben der SPIELBERGER Hof. Er war so verborgen, daß man in Kriegszeiten die wertvollste Habe hinbrachte und das Vieh zu ihm trieb. Weil er überall hingehörte, zur Gemeinde Höhenrain, zur Schule Helfendorf, zur Pfarrei Egmating, zum Friedhof in Münster und zur Post in Glonn, gehörte er ganz sich selbst; nur sonntags gehörte er von 1860 bis 1914 den Münchnern, die hier in großen und kleinen Gruppen zur Rast das billige hauseigene Bier tranken. Weiter hinan und hinauf geht es ins Hochland der Heimat nach LOIBERSDORF und MÜNSTER. Da ist eine Landschaft, in der man das Umschauen nicht vergessen darf, so purpurn leuchtet ein Dach zwischen den Bäumen, so landesväterlich grüßt der Wendelstein herüber und so silbergerüstet der österreichische „Kaiser“. Im kleinen Friedhof zu Münster kündet ein Stein vom „unvergeßlichen Jüngling Baltahasar Killi“, welcher der Brandlhausl war und der letzte aller Haberermeister, den zwar das Gefängnis nicht umbrachte — wir haben es schon erzählt – aber bei der Arbeit ein Holzscheit erschlug. Schon schaut auch LINDACH herüber, und sein winzigkleines romanisches Kirchlein bittet um Rettung vor dem Verfall. In Lindach schrieb Lena Christ „den urwüchsigsten altbaierischen Dialog, der jemals geschrieben worden ist“,nämlich den in der „Rumpl- hanni“, und für ein paar ihrer kraftvollsten „Bauerngeschichten“ hat sie in Lindach ihre Fabeln gefunden.
Fast läge es nahe, jenseits des Forstes noch EGMATING aufzusuchen, das Nachbarpfarrdorf mit dem massigen Turm und dem Gebäude der einstigen Zinneberger Brauerei. Beide sind in Tuntenhausen auf das Schönste in einer großen Votivtafel verewigt und mit einem aufschlußreichen amüsanten Spruch versehen: „Maria, nimm in deinen Schutz, / was heute wir dir weihen: / Den Wald, daß er der Nonne trutz, / das Herz den Zechereien“.
S. 97
Aber hier nähme uns schon der Schulbus nach OBERPFRAMMERN mit, wo in der Kirche ein adelig-schöner Christus aus der Hand oder der Schule des großen Landshuter Schnitzers der Spätgotik, des Hans Leinberger, zu finden wäre. Nun fahren die Busse die Buben und Mädchen von Pframmern, Moosach, Alxing, Berganger, Baiern und Egmating zur Hauptschule nach Glonn, und wer gut hinschaut, freut sich, daß sich die Kinder trotz aller Vermengung in der Hauptschule noch ein wenig Ortsspezifikas bewahrt haben; manchmal kennt man sie schon an ihren Gesichtern und an ihrem Grüßen auseinander.
S. 98
Wir aber wenden uns heute von Münster mit all den kleinen Wiesenrinnsalen wieder dem Kupferbach zu und stehen bewundernd vor Kreuz und Hof des REISENTHALERS, zu dem heute noch Franzosen pilgern, weil sie dort auch während des letzten Krieges als Menschen unter Menschen lebten durften, so wie es 1916 oder 17 Lena Christ in ihrer ergreifenden Geschichte „Die Ostereier der Reiserbuben“ vorauserzählt hat. Munter plätschert der kupferschimmernde Bach durch die Einsamkeit. Nur in Hochwasserzeiten verlor er früher sein kindliches Gemüt, und die wildstürmenden Gräben, von den Höhen gehetzt, speisten ihn mit den Geistern des Zornes, dann standen wir in Glonn auf der Wache, um Bad und Mühle zu schützen; doch nicht selten hatte der Wies- müller es zu dulden, daß die reißenden Wasser mitten durch sein Haus stürmten. Darum hat man den Kupferbach gebändigt, aber ein wenig kommt er mir schon vor wie ein einmal lustiger Bursche, den später ein Eheweib allzuviel Zügel anlegte und so ein dasiges Mannesbild aus ihm machte. Aber der Glonn geht es nicht anders, auch sie darf sich nicht mehr nach der Laune eines Verliebten bald hier hin, bald dort hin wenden; man hat ihr sehr gerade den Weg nach Süden gewiesen.
Im hinteren Reisenthal (einst hieß es nach seinem Besitzer das Reisachertal, was aber nichts mit dem früheren Hauptlehrer zu tun hat) sitzt die Kuppel der Kirche von FRAUENREUTH wie ein riesiges Osterei mitten in der Wiese überm Hang. So schmuck wie die Kuppel, so schön ist die ganze Kirche und so sauber der ganze Ort. „Rait“ hieß es im 14. Jh, „unser Fraun Rait“ 1416 und mundartlich heißt es noch heute „z’Reith”! Als „Sedes sapientia” (1500), als Sitz der Weisheit, thront die schöne Muttergottes, das offene Buch auf dem Schoß, das Antlitz im Augenblick der Meditation, das Auge nach innen gerichtet. Alte Votivtafeln erinnern an die Zeit der Wallfahrtszüge; ein eigener Gesellpriester ward angestellt. Der Thomas Mayr, Maurermeister aus Grafing, war wahrscheinlich der Baumeister der neuen Kirche nach 1700. Die alte Kapelle mit dem spitzen Türmlein soll ein reicher Kaufmann nach glücklicher Heimkehr von einer gefahrenvollen Reise gestiftet haben. Das Gewölbe ist verhalten-fein stuckiert. Ikonographisch ist ein großes Tafelbild bemerkenswert, die letzten Dinge allegorisch und darstellend Christus als Müller: „Zu landt und Wasser oder andern Straßen / muß man zu der mil mit unseren Lasten“. Kaum bekannt ist ein anderes ganz entzückendes volkstümliches Bildwerk: Aus 48 quadratischen Gehäusen blicken in winzigen, farbig gefaßten Schnitzereien die Büsten oder Symbole von 48 vielverehrten Heiligen; da ist der Haibackt von St. Sebastian, Elisabeth mit Krone und Armenbrot, der zierliche St. Veit und die schöne Sünderin Magdalena mit dem Salbengefäß. Noch nie ist mir eine Heiligentafel in dieser Art begegnet, auch nicht in der einschlägigen Literatur.
S. 99
 Glonner Votivtafel in Frauenreuth
Glonner Votivtafel in Frauenreuth
Vorbei am HAFELSBERG mit dem Cusanushof, einer prächtigen, in einen Bauernhof eingebetteten Bildungsstätte der Hettlagestiftung, geht es nach MATTENHOFEN. Das Schloß, 1827 noch den Arcos überschrieben, ist verschwunden; es war ein schlichter Bau mit 2 Stockwerken und hohem Dachgeschoß und zählte etwa 70 Fenster, und unter sich, nach Wening, „ganz ungleich erbaueth der Unthanen Häuser“, so den Schloßmaurer, der 1798 noch im Schloß gewohnt hatte, und den Bruckmoar und oben am Waldrand, mit dem schönsten aller Hausnamen, den Schnepfalucka. Einer der gescheitesten Mattenhofener Abkömmlinge, der Sepp Sarreiter in München, arbeitet seit Jahren an einer Mattenhofener Chronik, und er hat sich schon bis 1160 zurückgekämpft; damals wurde ein Mattenhofener Besitz dem Kloster Chiemsee übergeben. Die alten Mattenhofener Wappentiere, die Gans und das Eichhörnchen, erfreuen sich rundum des lebendigsten Daseins. Voller Liebreiz und Licht liegt das Land der Glonn, das gegen Süden zieht. Bewaldete Hügelkulissen stellen reizvoll ihren Fuß ins Tal und huldigen auf dieser Bühne voll Anmut und Tiefe den fernen Bergen, deren Weiß und Blau ein altbaierisches Kernland ausweisen.
Die Glonn überquerend suchen wir in seiner Haselstaudenschlucht das überaus originell ins Naturgelände eingebettete HASLACH. Es taucht urkundlich schon 1050 auf und hat seine Kirche dem hl. Koloman gewidmet, dessen Verehrung vom österreichischen Donaukloster Melk zu uns gekommen ist. Auf den feurig-gemalten Bildern aus dem Leben des Heiligen von 1646 an der Emporenwand steht zu lesen: „St. Koloman In Esterreich und bairlandt, / auch allhier wol bekhandt“.
S. 100
Leider finden sich von der früheren reichlichen Freskenmalerei an den Wänden, dieser Bibel der Armen, nur noch kümmerliche Reste. Auf dem Altar knien zu Füßen des hl. Pilgers die Stifterfiguren in zeitgenössischer Tracht. Hinter dem Altar unter dem reichen Netzgewölbe entdeckst Du das Wappen der Pienzenauer. Die Kirche ist sehr sauber und gepflegt gehalten und wird gut bewacht. Als die Mesnerin einem fremden Geistlichen die Schlüssel auslieh, schickte sie ein Kind zu dem wartenden Auto, die Nummer zu notieren.
 Im Glonntal: Blick gegen Mattenhofen
Im Glonntal: Blick gegen Mattenhofen
S. 101
Der Fremde konnte solche Vorsicht nur loben; es war nämlich der Kardinal aus München. Gewiß gefiel ihm auch die baierisch-liebliche Schönheit der Madonna mit ihrem Apfelbacken gesicht und der sie ein wenig beschwerenden Krone auf dem Haupt. Hohe Aufmerksamkeit aber verdient die gotische Kreuzigungsgruppe, die dem rühmlichen Meister von Rabenden zugeschrieben wird, dessen Namen man nicht kennt, dessen Werkstatt man in Rosenheim vermutet und aus dessen Kirchen „man erquickt hinausgeht wie nach einem Bad“.
S. 102
Sein Hauptwerk sind die Altäre von Rabenden, dem kleinen Dorf an der alten Poststraße von München nach Salzburg. Da fällt einem nun auch jener Bauernbub von Rabenden ein, der so volksverbundene Gründer von Piusheim, G. R. Sebastian Hainz, dem die Direktoren Seidl und
Fiedler folgten, welch letzterer das neue „Jugenddorf“ baute.
Ein rechtes Grenzheiligtum, so zwischen den Pfarreien Glonn und Schönau und zwischen den Gemeinden Glonn und Baiern gelegen, ist das in einem Wald- und Wiesental verborgene Kirchlein von FRAUENBRÜNNDL. Das vielverehrte gemalte Gnadenbild in seinem hübschen Glanzgoldrahmen ist die Mitte des kleinen baldachinartigen Altars von Joseph Gölsch. Leider wurden zwei lieblich-innige Engel 1962 geraubt. Bei dem alljährlichen Frauenbrünndlfest kommt von rundum gläubiges Volk, drängt sich ums Kirchlein und lagert unter den Waldbäumen des östlichen Hanges, betend und singend und der Bergpredigt lauschend.
Lang war die Fahrt zu den Dörfern rundum, reich die Ernte an Landschaft und Kunst. Aber was macht ein Dorf wirklich aus.
 Die lieblich-ländliche Maradonna von Haslach
Die lieblich-ländliche Maradonna von Haslach
S. 103
‘s Dörfe
In ara Muidn, hinter de Buckl, do duckt sa si nieda;
für de Leut, de dort hausn, is dös a net zwida;
muaß net a jeda a Wissats vo eahna do hom,
lust eh ja scho ’s Bacherl do drunten im Grobm;
und dös bleibt net do, laft außi in d’Wöit,
und hot draußn scho öfters vo de Leut
wos vazöit,
wias redn und wias liabn und wias hausn
mitanand,
wias Kinda kriagn und Bleami ziahngn und
arbatn am Land.
Und Herbst is und d’Sunn scheint, auf de Berg
liegt da Schnee,
am Dörfe is recht, eahm tuat da Winter net weh,
is schö z’sammg’ruckt, schö zuadeckt,
liegt Doch ja an Doch,
und grod a oanzigs Fensta blitzt
da Sunna no noch.
Und ‘s Kreuzl vom Kircherl, aufm Zwiebturm
drobn,
dös gibt no an Segn und tuat ‘s Dörfe no lobn.
A Bulldog no dukkat, boid werst nix mehr
hearn,
ös muaß ja iatz dengascht boid Feierabmd
wearn.
De Acker broatmachti und de Wiesn dazua,
de san scho ganz stad, dö gebm scho a Ruah.
Grod de Buachn am Woidrand harn an Glanz
si no g’hoit,
dös glitzert und glutzert und tropfats wia Goid.
Aba glei is vorbei, und a Stern schaugt scho rei.
Guat Nacht liabs Dörferl, liabs Dörferl schlaf ei!
Wolfgang Koller
S. 104
Sprache des Herzens — Die Mundart
Die Mundart ist eines der kostbarsten und lebendigsten Güter, die uns die Ahnen und die Zeiten überlassen haben. Die Mundart ist ein Brunnen, in dem man sich allezeit gesund baden kann und ohne den auch unsere Schriftsprache immer blässer würde. Sprich mit jedem seine Sprache, aber mit deinen Freunden sprich die Sprache des Herzens, sprich Mundart! Das Schuldeutsch und der Rundfunk und das Fernsehen haben manches an ihr verdorben; sie ist ärmer geworden und ist dennoch immer noch reich an Farbe und Kraft. Und wer eine Mundart sein eigen nennt, der ist nicht sprachärmer, sondern sprachreicher; er spricht eine Sprache mehr als der andere und hat dabei wahrlich keine Fremdsprache lernen müssen.
Ein Stamm, der seine Sprache nicht mehr spräche, bliebe nicht derselbe Stamm. Der Bischof Gargitter von Brixen hat gewußt, was er seinen bedrängten Südtirolern aufs Herz binden mußte, als er ihnen schrieb: „Bleibt Eurer Heimat treu bis in den letzten Laut Euerer Mundart hinein!“ Die Tragik im Leben der Lena Christ beginnt genau dort, wo ihr der rührend-besorgte Großvater auf der Fahrt „zur Minkara Muatter“ sagen muß: „Jatz derf ma nimmer Kuchei sogn, iatz hoaßts Küch, und statt der Stubn sagt ma Zimmer und statt ‘n Flöz sagt ma Hausgang …“.
Es ist nicht mehr viel Platz in diesem Buch, mich über die baierische Sprache, so wie sie landstrichmäßig eingefärbt in Glonn und noch echter in den Dörfern und noch ursprünglicher und älter in den Einöden oder im Baierer Winkl gesprochen wird, zu verbreiten, und dazu die Geschichten zu erzählen, die wahren, die ich in 40 Jahren gesammelt habe. „Do waar ja a ganz Buach zum Schreibn und net dös schia- cha!“ Wenigstens ein paar Mundartproben sollen hergesetzt werden, und ich bin überzeugt, daß diese nicht bloß den „Selbmzügelten“, sondern gerade auch den „Zuazongan”, den „Reing’hocktn“ und „Fremdn“ Spaß machen werden.
Bei uns gibts heut noch eine rundscheiwige Uhr und an broatflischatn Huat, aber auch a Wuzal, a Buzal, a goidigs Speranzal. Do werd da Bua vom Vätern amoi g’flaxt, boi ers braucht, und er hoits aus, er scho! Do grüaßt da Bursch an Zaun (= die Mutter der Verehrten) wegan Gartn ( = dös gschmoche Dirndl). Do is der Sepp ganz läppert mitm Lisei; aber sei Muatta is a wenig „kritlisch“ und dakemma is aa, wias dös g’hert hot: „Moanst, daß Di di mog, an so an Gauschterer (= ein Wirbler) wias du bist und so a bsuffas Wogscheitl dazua? Aber der Sepp gibt net auf: „Soll d’Lis vielleicht an rechtn Loahdi (= einer der sich müd anlehnt) oder Loamsiada nehma, daß no singa kannt: „Gfreut mi nix wia mei Mo, / weil er ois a o ko: / Boid ißta, boid trinkta, / boid loaht er si o“. Einig sind sich der Sepp und seine Mutter, daß sie dem Vater vorerst nix sogn, der is grod a weng honax (= krank), da Wehdam is net so gfährli, er is hoi grüglat (= halskrank).
S. 105
Und wenn der Vater beim Fenster nausschaut und sagt seiner Hauserin, daß „zwee“, „zwo“ oder „zwoa“ vorbeigehn, dann weiß diese, ob es Männer, Weiberleut oder Kinder sind. Daß man mit den Nachbarn zu grob ist, mag der Vater nicht: An Zaun oniloahna derfst oan, aber umischmeißen derfst ‘n net (= keine unreparable Feindschaft verursachen!). Darum mag er es nicht, wenn die Frauenzimmer zu viel von den Fehlern anderer reden: „Dös is a G’schmatz, dös hot koa Hoamat net“. Mit der Wahrheit nimmt er es selber ganz genau: „Mit dem Mäu, mit dem i bet, lüag i net“.
Was er gar nicht leiden kann, ist ein grobes Wort der Kinder zu der Mutter: „Dös laßt fei bleibn, dös taat da Muatta ant“ (ein uraltes Wort, bedeutet etwas, was weh tut, weil man so etwas nicht gewöhnt ist). Wenn unter Eheleuten nur viele so denken würden wie er: „Is grod schod um jedn Tog, wo ma net guat is zu- anander“.
Freili gibt es auch so Poitara und Sakramen- liera. Mein Freund, der niederbayerische Lyriker Robert Erbertseder, hat den mit solchen Mannsbildern geschlagenen Hauserinnen das Wochenlied gesungen: „Wenn mei Mo am Mo- da / aufsteht, nachher grot / und schimpft a scho. / Mei Gott, is mei Mo a Mo.“ Am Irta {= Dienstag) lamentiert er, und dann geht‘s weiter Mika, Pfinsta (= Donnerstag), Freita, „und na masselt er und mamsta / grod a so am Samsta. / Oiwei wieder fangt er o. / Mei Gott, is mei Mo a Mo.“ Ja, ja, dös is scho a Kreuz und koa Herrgott net dro!
Wia liab is dagegen so a Großmuatta und wos is sie für a Segn! Da Vater und de Muatter habm sovui gon denka und sovui gon toan, aber Großmuatter hot d‘ Zeit; sie lebt ganz für de andern, für si selba bloß nebnbei. Und sie muaß oiwei de G’scheitere sei! Und welche innige Zärtlichkeit liegt darin, daß einmal eine von ihnen zum Enkelkind sagte: „Geh, sog Mutta zu mia, Groaßmuatter is gar a so a Mäu voi!“ Und iatz nix für unguat (= nichts für ungut nehmen!), Ihr lieben Glonner Landsleut, Ihr altbaierischen und Ihr andersstämmigen, i grüaß Enk (Enk, das ist noch ein uraltes Wort aus dem Gotischen), i grüaß Enk herzli und i sog: I mog Enk. I mog Enk, aa wenns net olle boarisch könnts.
A Liab zu de Leit
Ma hot in da Hoamat a Liab zu de Leit,
ob s‘ im Kopf a weng oafach sand oder
g’scheit;
ob s‘ arm sand oder reich, ob s‘ an Bauernhof
ham
oder grod a oite Hüttn a da Holzleitn am;
hot Oana ois Burgamoaster ‘s erste Wort
z’sogn
oder tuat er grod d‘Briafpost und d’Zeitung
austrogn.
Ob a Fischwasser eahm g’hert, a ganza Haufa
Hoiz,
ob a Gartl sei Freud is oder a G’schäftshaus sei
Stoiz:
Aber d’Hoamat muaß eahm wert sei und net
grod sei Sach,
und unser Land muaß er gern hom und
redn unser Sprach.
Wolfgang Koller
S. 106
S. 107
Eine Handvoll altbaierische Art
- Der Altbaier will frei sein und freisein lassen. Er will ein freier Mensch sein, weil er ein vollständiger Mensch sein will. Man sagt auch nicht: Jetzt m u ßt Du, sondern man sagt: „latz derfst wieder arbatn“. Um der Freiheit willen, baut er gerne in die Einöde oder auf die Bergkuppe, da hat er niemand neben oder über sich.
- Er hat ein Gefühl für seinen Selbstwert: „Grod is ma ei’gfoin, daß i aa wer bi“! Ein einziger Buchstabe kann sein Selbstgefühl aus- drücken und dieser Buchstabe steht da wie ein Mannsbild: I und hinter dieses I gehört ein Rufezeichen! “Wer hot das Fenster eingeworfen?“ „Herr Lehrer, i!“ „Tuast du denn so wos?“ „ I scho!“ — Es ist nicht lange her und nahe bei Glonn ist es passiert, da stand das Fräulein an der Wandtafel, das nützte ein Erstkläßler aus und zwickte die Lehrerin ins rundliche Gesäß. Wütend wandte sie sich um. Da sagte der Bub: Göi, do schaugst!
- Gegen das bloß Neue und das bloß Fremde ist er mißtrauisch. Er hat eine Witterung für echt und unecht. Kommt was Neues, sagt er gern: „Ja iatz scho, aber nochher??“ — 1933 hatte ein Knecht den „Deutschen Gruß“ verweigert; vor dem Amtsgericht Ebersberg erklärte er: „Herr Amtsrichter, dös ko koa Mensch vo mia valanga, daß i d’Hand laar aufheb“.
- Er mag das Warmherzige! Als ich eine Austragsbäuerin über eine neue Nachbarin befragte, sagte sie: „Was mi betrifft, von der gehts net hoaß weg und net koit“. Welche Wärme und Zärtlichkeit liegt in der Strophe: „Du tausendschöns Bleamei, / du Himmesschlüssei, / grod bei dia möcht i sei, / a kloa winzigs bissei“.
- Gegen Unrecht ist er empfindlich, auch gegen jenes, das einem anderen zugefügt wird; da kann er dann scharf werden: A so oana wias du bist, harn si bei uns dahoam d‘Hen- na vom Mist außakreit. — Ein Glonner erlebte in der Münchner Straßenbahn, wie eine junge „Dame“ sich lauthals über eine Mutter mit einem kleinen weinenden Kind auf dem Schoße aufregte. Da stieg dem Glonner ein gerechter Zorn auf: „Sie, Fräulein, Sie habn gar keinen Grund, sich über dieses Kind aufzuregen; wie Sie so kloa warn, da warn Sie noch vui fader, das merkt man heut noch“. Die Umsitzenden stimmten lachend zu, die „Dame“ stieg an der nächsten Haltestelle aus und siehe, das Kind hörte zu weinen auf. Aber die Geschichte müßte man einmal ausführlich erzählen!
- Gegen Unrecht ist er empfindlich, auch gegen jenes, das einem anderen zugefügt wird; da kann er dann scharf werden: A so oana wias du bist, harn si bei uns dahoam d‘Hen- na vom Mist außakreit. — Ein Glonner erlebte in der Münchner Straßenbahn, wie eine junge „Dame“ sich lauthals über eine Mutter mit einem kleinen weinenden Kind auf dem Schoße aufregte. Da stieg dem Glonner ein gerechter Zorn auf: „Sie, Fräulein, Sie habn gar keinen Grund, sich über dieses Kind aufzuregen; wie Sie so kloa warn, da warn Sie noch vui fader, das merkt man heut noch“. Die Umsitzenden stimmten lachend zu, die „Dame“ stieg an der nächsten Haltestelle aus und siehe, das Kind hörte zu weinen auf. Aber die Geschichte müßte man einmal ausführlich erzählen!
- Er kann sich selber auf den Arm nehmen. Einen ehemaligen Schüler fragte ich bei einem Wiedersehen, wie es ihm im Kriege ergangen wäre. Er antwortete: „Net ganz schlecht! I hob zwar an Kriag valorn, aber mei große Verwandtschaft hot’n g’wunna“. (Sein leiblicher Vater war nämlich ein kriegsgefangener Russe aus dem ersten Weltkrieg gewesen.)
- Er ist schlagfertig und hat Humor. Da ging einmal der Herr Kurat an der Kiesgrube vorbei und redete den Kieswärter freundlich an: „Du host eigentlich a schöne Arbeit. Bist weg von de Leut, niemand redet Dir was ein und bist immer in der guten Luft“. Der Kieswärter aber meinte: „Is net ganz so guat, Herr Kurat! Im Sommer is z’hoaß, im Winter is z’koit und wenn’s ganz recht waar, is Osterbeichtzeit“.
- Er kann auf seine Weise Rücksicht nehmen. So sagt er diskret: Heuer is ‘s Grummet länger wia ‘s Heu! (Dann weiß das Mädchen, daß ihm der Unterrock vorsteht). — Eine wohlbehütete und vornehm erzogene und nichtbaieri- sche Hilfsschwester im Lazarett Zinneberg fragte einmal einen der Soldaten, wo er denn verwundet worden sei. Der sagte ganz ungeniert: „Am A …, Schwester“ und benannte dabei in heimatlicher Weise sein Gesäß. Die Schwester verstand das nicht gleich, aber sie hatte das Gefühl, daß sie verlegen sein müsse. Da bereitete ein anderer Verwundeter der Verlegenheit ein glückliches Ende: „Wissen ‘S, Schwester, dös is a Ort in Galizien.“
- Mit dem Herrgott versteht er sich auf seine Weise: Als vor kurzem ein redlicher Glonner Rentner auf seinem Sterbelager anordnete, daß das Leichenmahl unbedingt beim Neuwirt sein müßte, und sein Schwiegersohn ihm erklärte, daß dort noch acht Tage Betriebsferien wären, sagte der Kranke: „Dann muaß da Herrgott halt noch 8 Tag wartn.“ Und er wartete. Setzen wir noch die schönste aller altbaierischen Grabinschriften hierher, auch wenn diese nicht von Glonn stammt
„Hier liegt der Laufner Bot!
Oh, lieber Herre Gott,
gib ihm das Ewig Leben!
Er hätt Dirs auch gegeben,
wärst Du der Laufner Bot
und er der liebe Gott“.
 De Soalamualta von Prof. Sepp Hilz
De Soalamualta von Prof. Sepp Hilz
S. 109
Baierische Brocken — Ein paar wahre Geschichten
In der Maiandacht Ein kleines Dirndl durfte erstmals mit der Dirn in die Kirche und zwar in die Maiandacht gehen. Zu Hause fragte die Mutter: „Ja, Dirnei, wia wars denn in da Kirch?“ „0 mei, do wars sovui schö“, erzählte begeistert die Kleine, „sovui Liachta habm brunna, a da Poalam drobn (= Empore) harn s‘ so laut to und darnoch is oana rumganga und hot Kunstdünger g’saat“ (= das Weihwasser ausgeteilt).
Das Vaterunser Die fünfjährige Hanni kommt zur Tante und erzählt ihr, daß sie „den ganzen Vaterunser“ kann. Und schon haspelt sie ihn hurtig herunter. Die Tante meint: „Wenn du so schnell sprichst, dann versteht dich der liebe Gott ja gar nicht.“ Die Hanni resolut: „Dös glaab i net, der versteht ja sunst aa ois“.
Die große Badewanne 3, 4 und 5 Jahre alt sind die Kinder auf dem bäuerlichen Hof. Sie werden am Samstag miteinander in die Badewanne gesetzt und abgeschrubbt. Als die fünfjährige Barbara anläßlich eines Besuchs bei ihrem geistlichen Onkel, der von zwei Schwestern betreut wird, die große städtische Badewanne sieht, fragt sie: „Du Onkel, werdet ihr drei da auch auf einmal hineingesetzt und abgeschrubbt?“
Die Kohlrabigeschichte Sonntag ist’s. Der Weindl liegt auf seiner Altane und liest die Zeitung. Da kommen zwei Nachbarsbuben angeschlichen, alle zwei blond und plattfüßig. Der größere, der Schorschi ist ein Stotterer. Er zieht den kleineren Maxi mit sich an den Zaun und sagt: „la – – latz, schsch – – schteig umi!“ Da Maxi: „I trau ma net“. Da zeigt ihm der Schorsch eine Zaunlücke und meint: „Ia _ – – iatz trau da, i fff – – -ühr da d’Hand“. Und schon hat der Max einen Kohlrabi und dahin gehts mit den zwei Buben. Aber bald darauf läutet es beim Weindl. Wer steht draußen? Der Schorschi; ganz aufgeregt berichtet er: „Wwwweindl, da Maxe ho … ho … hoot da an Kohlrabi g’stoin, a an ganzn an großn“. Der Weindl holt sein Fernrohr und sagt: „Do muaß i glei an Himme naufschaugn, wos dö sogn?“ — Der Schorsch, der ein gutes Gewissen zu haben scheint, fragt: Wo … woos sogns denn??“ Der Weindl ruckartig: „Woaßt wos sogn? Du host eahm d’Hand g’führt“! — Da ist der Schorsch aber dakemma. „Pfff.. pf.. pfüa Gott beinand“ bringt er noch heraus und draußen ist er bei der Tür.
Die hübsche Lehrerin In Tuntenhausen fragt die junge Lehrerin Christa ihre Schulanfänger, ob ihnen die Mutter schon etwas vom „Fräulein“ erzählt habe. Da meldete sich ein kura- schierter Bub aus einem Nachbardörfl: „D’Mam hot nix gsogt, aber da Pap hot wos gsogt!“ — „So, wos hat er dir dann erzählt?“ — „Da Pap hot g’sogt; dös Luada hot saubere Haxn“. — Als ich später das Fräulein Christa einem meiner beiden Nachfolger, dem Schulrat Obermayr, vorstelle, tritt dieser ein paar Schritte zurück, mustert die junge Kollegin und sagt: „Da Pap hot recht g’habt!“ Und darum habe ich die Geschichte auch nicht mehr vergessen.
S. 110
Da Alisi Er ging 1924/25 in die 1. Klasse in Glonn, war von Münster und strotzte von Gesundheit und Kraft. In der Pause wußte er die größten Mädchen durch einen Sprung und Griff nach ihrer Affenschaukel (so hieß man die zusammengebundenen Zöpfe) auf den Rücken zu legen. Tatzen nützten nichts. Er war von seinem Vater eine bessere Kost gewöhnt. Das Einsperren war auch nicht von Wirkung; es pressierte ihm ohnehin nicht nach Hause. Da drohte ihm das Fräulein Fink mit dem Schulrat. Und dieser kam an einem schönen Morgen Ende Mai von Griesstätt her angeradelt. Er hatte eine rauhe Stimme, trug eine dicke Brille und konnte, wenn er wollte, auch noch schielen. Die Kinder erschraken und die Lehrerin auch. Der Alisi in der ersten Bank beschloß, sich für diesen einen- Tag totzustellen; das hatte er von gewissen Käfern in der Natur gelernt. Brav saß er und brav stand er auf, wenn er gefragt wurde, da hielt er dann den Kopf noch ein wenig schief, aber Antwort gab er keine, auch nicht auf die einfachste Frage. Das wurde dem Schulrat Stoll nach 10 Uhr zu dumm. Er nahm ihn selbst vor: „Habt ös Henna?“ Der Alisi nickte nicht einmal mit dem Kopf. Nächste Frage: „Legt bei enk da Gockl aa Oar??“ Keine Antwort! Der Schulrat zeigte zum Fenster: „Do schaug naus, do fliagt a Ochs“. Der Alisi schaute nicht hinaus; er wußte schon, daß das „Kraampf“ wären. Da zog der Schulrat sein feststehendes Messer heraus, legte es dem Alisi auf das rechte Ohr und drohte: „Sagn, wennst nix tuast, schneid i dir pfeigrod deine Ohrn ab“. Ein kleines Bacherl rann zur Bank hinaus, aber das war nicht vom Alisi sondern von seinem Nachbarn; der Alisi hatte bessere Nerven! Aber sagen mußte er jetzt etwas. Er faltete sehr fromm die Hände und betete: „Herr, du bist bei mir, mir kann nichts fehlen . . .“ Das war der Anfang eines Gebetes bei einem Gewitter. Die Woche vorher hatten es die Buben gelernt. „Wenn Tausende fallen zu meiner Seite . .“, so wäre das Gebet weitergegangen, aber der Alisi brauchte den Vers nicht weiter zu sagen; den Schulrat schüttelte es vor lauter Lachen und erlöst lachte nun die ganze Klasse über den Schulrat mit dem blitzenden Messer in der Hand. Der Alisi war erlöst und das Fräulein auch; die Visitation war zu Ende.
In der Beichte Beim 5. Gebot gackste ein Schulbub lange herum, aber dann brach es wie aus einem überdrehten Wasserhahn aus ihm heraus: „Ich habe dem Herrn Lehrer das Verrecken gewünscht . . . wöchentlich dreimal.“
Die große Versuchung Der Herr Pfarrer läßt in der Schule Beispiele erzählen, wie die Kinder durch den Bösen schon versucht worden sind. Das anschaulichste Beispiel bringt am Ende der Waste: „Mich hat der Satan auch einmal versucht. Es war im Bett. Er sagte mir: „Pißle ins Bett! Ich aber hab’ ihm widerstanden; ich bin aufgestanden.“
Die Erklärung Eine Mutter überfährt das Fräulein in der Schule: „I woaß net, wos bist du für a Lehrerin? latz bist so gscheit und hast es no net gmerkt, daß aus meiner Tochter nix z‘macha is; i hob nix glernt und mei Mo is a ganzer Depp“. Die tüchtige Lehrerin hat aber einen Einwand: „Ich hab doch ihre größere Tochter auch schon gehabt; die war gar nicht so schlecht“. Da entgegnet die Mutter energisch: „Die konn leicht besser sei, die hot ja an andern Vater“.
S. 111
Er kennt sie auch nicht Am Marktmontag sitzt der Hiasl beim Huberwirt; er ist seit dem Sonntag nicht nach Hause gekommen und daheim bleibt das Heu auf der Wiese liegen. Seine Frau kommt schließlich nach Glonn geradelt und findet endlich ihren Glückseligen. Ohne ein Wort zu sagen, tritt sie an den Tisch und zieht ihm eine runter, daß der Hiasl, ohne zu einer Widerrede zu kommen, halb freiwillig, halb unfreiwillig untern Tisch rutscht. Und schon ist die Frau wieder bei der Tür hinaus. Ein Ortsfremder am Tisch fragt den Hiasl: „Ja, wer war denn dieses Frauenzimmer?“ „Ja“, sagt der Hiasl, tut unwissend und schüttelt den Kopf: „I kenn s‘ aa net“.
Zum Frieden gesinnt Einer aus der Gegend ging oft recht spät vom Wirtshaus nach Hause; aber er brachte dafür immer seiner Frau etwas mit. Einmal wurde es ganz besonders spät. Seine Frau öffnete die Haustür. Er hielt ihr ein Packerl hin: „Mama, i hob dir vier Dicke mitbracht.“ Die erboste Frau warf das Geschenk wütend hinter sich. Da fragte sie ihr Mann im sanftesten Ton: „Mama, sand dir de Würst obig’foin??“
Fremdwörter „eingedeutscht“ Der Huber Hausl hatte mit Recht eine Abneigung gegen ausländisches Gered; Fremdwörter deutschte er auf seine Weise sinnvoll ein. So erzählte er einmal beim Neuwirt: „Habts as scho g’hört? Da Direktor vo Piusheim hot an noglneuen Mussolini (Limousine); aber mir waar wieder liaba a Motorradi mit am Sitzidus.“
Heuer anders 30 Jahre lang hat der Emmeram dem Herrn Pfarrer jedes Frühjahr gesunden Mist in den Garten hinübergefahren. Aber als der Emmeram Bürgermeister geworden war, zerhakelte er sich wegen des Baues eines Jugendheims mit dem hochwürdigen Herrn. Trotzdem fuhr er beim nächsten Auswärts un- angeschaffterweis und wie gewohnt ein Fuder Mist zum Pfarrhof. Da kam die Schwester des Herrn Pfarrers heraus und sagte: „Emmeram, Du därfst den Mist wieder hoamfahrn; der Herr Pfarrer moant: Heuer probiern mas amoi mit ‘m Kunstdünger.“ Die beiden Zerstrittenen haben sich bald darauf wieder ausgesöhnt und die üppigen Gurken und Bohnen im Pfarrersgarten verraten, wie gut ihnen des Bürgermeisters Mist wieder tut.
S. 112
In gefährdeter Landschaft – Ein Schlußwort
Wahrheit zu finden und auszusagen und die Liebe dabei nicht zu verletzen, ist mühevoll. Um beides habe ich mich in dieser Schrift bemüht.
Vieles hat sich seit 20 Jahren wieder zum Unguten verändert. Vieles hat sich ins Gefahrvolle hinbewegt. 30 Jahre genügten, um ein Meer von Blut und Tränen schon wieder zu vergessen. So fragen wir uns alle: Was wird aus unseren Kindern und Kindeskindern, was wird aus unserer Heimat, was aus dem christlichen Abendlande, was aus unserer Freiheit werden?
Ein Jahrtausend geht zu Ende. Häuser vergehen, Bäume vergehen, Menschen versinken, Freunde und Nichtfreunde, Kriege vergehen, Ruhm verweht. Aber über allem, was vergangen und vergeht, leuchtet das Unzerstörbare. Leisten wir diesem unseren bescheidenen Dienst in der schwindenden Zeit!
Gegen den Terror des Aktuellen setzen wir den Wert des Bleibenden, gegen die Oberflächlichkeit das Innerliche, gegen die Hektik der Tage das In-sich-Ruhende, gegen die müde Trauer der auseinandergehenden Glieder die Freude zur menschlichen Nachbarschaft, gegen den Wirbeltanz der Hin- und Hergerissenen die Treue zu den Freunden, gegen die Verfremdung setzen wir die Heimat, in der das Heilige und das Heitere noch nicht auseinandergebrochen sind. Wir durften die Heimat behalten, damit wir sie erhalten.
Möge denn die Heimat immer wieder Frauen haben, die Brücken nicht einreißen sondern bauen, die zu lieben wissen, wenn Männer in törrichte Streite geraten! Möge Glonn, wie seit zwölfhundert Jahren, immer wieder auch Männer haben, die hart sind gegen sich, gütig zu anderen, tüchtig für andere, dankbar den anderen und liebevoll-streng zu den Kindern! In diesen Kindern möge sich das Unbekannte, das auf sie zukommt, mit dem verbinden, was uns heilig ist!
Gott hat es gut mit uns gemeint, als er uns diese Heimat gab. So laßt uns einander mit Heimat umgeben! Ohne Ansehen, ohne Rang könnte ich in Glonn leben, ohne geliebt zu werden, nicht, und nicht ohne die Zuneigung der Landsleute. So widme ich diesen, und mit ihnen dem Andenken meiner Eltern und meiner Brüder, diese bescheidene Schrift und schenke sie meiner Heimat.
Glonn, vor Ostern 1974
Wolfgang Koller
S. 113
Benutzte Quellen
Joh. B. Niedermair „Glonn und Umgebung in Vergangenheit und Gegenwart“, 1909 und 1939. — H. Huber „Beiträge zur Geschichte des Marktes Glonn“ – Benno Hubensteiner „Bayerische Geschichte“ – 1950 Dehio/Gall „Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Oberbayern“ 1952 – Einschlägige Veröffentlichungen in Zeitungen von Dr. H. Kästner, Hans Sponholz und Markus Krammer — Selbstgesammeltes Material und zahlreiche eigene Veröffentlichungen aus den letzten 50 Jahren. — Urkunden und Aufzeichnungen aus dem Hause Arco-Zinneberg, für dessen frdl. Entgegenkommen herzlich gedankt wird.
Besonderer Dank gebührt Lehrer Lászlò Schwarzenberger für die liebevolle Besorgung der Bebilderung des Buches, die ihm von der Gemeinde übertragen worden war, und für die Zuverlässigkeit seiner Mitarbeit!
Übersicht
Das Jahr 774 1
Kelten und Römer färben uns ein, Bajuwaren sind wir 6
„Geschichte bis zum Schluß der Geschichte“
Die Anfänge des Christentums 9
Hirten und Herren – Auf den Stufen der Pfarrgeschichte 11
Langer Sorgen Lohn – Die Geschichte des Kirchenbaus 13
Josef Götsch – ein tragisches Leben und sein Werk für Glonn 16
„ Eh ma si‘ umschaugt…“ – Erinnerungen im Glonner Friedhof 20
Glonner Welt- und Kriegsgeschichte 24
Glonns Schulen und ihre Herbergen 26
„Ein Lagebericht“ – Glonn zwischen 1800 und 1868 32
Die Kriege und 46 Jahre Frieden – 1868 -1918 35
Die Heimat behauptet sich – 1918 – 1945 45
Werke einer friedlichen Zeit- 1945 – 1974 49
Leute von Rang – Sie trugen Glonns Namen in Land und Welt 54
Lena Christ – Der Glanz ihrer Werke und ein merkwürdiges Leben 61
Kunst und Literatur der Gegenwart 64
Das Schloß auf dem Berg und seine Geschlechter 68
Die Preysing, die Pienzenauer, die Grafen Fugger,
die Arcos, die Pallavicini, die Barone von Scanzoni u. Büssing,
die guten Hirtinnen
Maria Leopoldine, Retterin Bayerns, Schloßherrin auf Zinneberg 76
„Ein gottseeliges Land“ – Fahrt zu den Dörfern 82
Schlacht, Kreuz, Reinstorf, Balkham, Steinhausen,
Mühlthal, Kastenseeon, Adling, Doblberg, Steinsee, Altenburg, Moosach,
Wildenholzen, Sonnenhausen, Westerndorf, Hermannsdorf, Georgenberg.
Wetterling, Berganger, Weiterskirchen, Baierer Winkl, Höhenrain, Elendskirchen,
Laus, Spielberg, Loibersdorf, Münster, Lindach, Egmating, Oberpframmern,
Reisenthal, Frauenreuth, Hafelsberg, Mattenhofen, Haslach, Frauenbrünndl
Sprache des Herzens – Die Mundart 105
Eine Handvoll altbaierischer Art 108
Baierische Brocken – Ein paar wahre Geschichten 110
In gefährdeter Landschaft – Ein Schlußwort 113
Wolfgang Koller
Wolfgang Koller wurde am 6. November 1904 im oberbayerischen Markt Glonn geboren. Nach
seiner Schulzeit in seinem Heimatort (1911 —1918) und dem Studium in Freising unterrich-
tete er von 1924 bis 1952 in bayerischen Volks- und Sonderschulen (Ramsau, Lkr. Wasserburg – Marzoll – Schrobenhausen – St. Christoph – Amerang – Dorfen, Lkr. Ebersberg — Bad Aibling — München – Schönau — Glonn).
Er wirkte als Schulrat in Erding und von 1957 bis 1969 im Landkreis Ebersberg. Wolfgang Koller, Vater des Lyrikers Bernhard Koller, veröffentlichte Laienspiele, darunter das bekannte „Schönauer Grippenspiel“; Gedichte von ihm erschienen in Anthologien. Zeitschriften und Zeitungen und 1969 in seinem Gedichtband „Wer zum Brunnen ist bestimmt“; er leitete Kunstausstellungen und schrieb Kritiken.
Am 28. April 1974 beging die Marktgemeinde Glonn den Höhepunkt ihrer Feierlichkeiten zum 1200-jährigen Jubiläum in einem Festakt. Die Festansprache an alle Landsleute und die Gäste, unter ihnen der Schirmherr der 1200-Jahrfeier, Ministerpräsident Alfons Goppel, und Erzbischof Julius Kardinal Döpfner, hielt Wolfgang Koller. Er starb während seiner Festrede im Pfarrsaal in Glonn.
Wolfgang Koller — Seine Festansprache
1200 Jahre Glonn. — Wenn ich Glonn sage, dann ist damit nicht bloß der Ort gemeint, nicht einmal bloß die Gemeinde, sondern das ganze Tal, das Auf und Ab der Hügel und der Wälder,- das ganze gottselige Land, in welchem der Wiesenwind um helle Kirchentürme und um bauernfürstliche Einödhöfe singt. Und wie unser Markt nichts wäre, oder arm wäre, wenn nicht die klaren Wasser ihn durchströmen würden, so wären wir auch viel ärmer hier im Markt Glonn, wenn nicht der Atem der Ursprünglichkeit Tag um Tag von den Höfen auf den Höhen und von den Fluren der Dörfer unsere Straßen durchlüftete; denn München ist nahe, und die große Stadt irrlichtert auch zu uns herein, und der Fernseher blendet, und so mancher Wegweiser unserer Tage ist auf Irrtum gestellt.
Und nun eine merkwürdige Frage: Sind 1200 Jahre eigentlich viel oder sind 1200 Jahre wenig?
1200 Jahre sind zwölf Jahrhunderte; und ist ein Jahrhundert gar so viel?
Der Landesvater mitten unter uns hat doch schon ein ganz gewaltiges Stück eines Jahrhunderts miterlebt und mitgetragen.
Und machen die Lebensjahre unseres Bischofs nicht schon mehr als ein Zwanzigstel der 1200 Jahre aus?
Und ist es nicht schon 10 mal 1200 Jahre her, seit die Eispanzer, die unsere Landschaft so anmutig geformt haben, sich zurückzogen bis auf den Pyramidenthron des Großvenedigers? Sie sehen, und ich entschuldige mich, daß ich auch ohne Mengenlehre schon eine Menge gerechnet habe, und ich rechne weiter: Ist der Berg unserer Heimat, der Wendelstein, nicht tausendmal älter als 1200 Jahre?
Und zwischen dem Weltenanfang, dem unerforschten, und dem Weltenende, dem unbekannten, da sind jedenfalls 1200 Jahre nur einige Augenblicke.
Und doch liegt das Jahr 774 in seiner geschichtlichen Frühe weit von uns. Damals hat der Sohn des Criminus, der Ratpot, seinen herrlichen Besitz mit Ländereien, schluchtenreichen Wäldern, wie er schreibt, mit fallenden Gewässern Freising geschenkt, dem Bischof von Freising, dem Nachfolger des Korbinian.
Und 438 000 und genau noch einmal 38 Tage sind vergangen seit jenem 21. März, da die Urkunde ausgefertigt wurde. Über 438 000 mal ist seit jenem Frühlingstag der Morgen aufgegangen und hat der Himmel seine Augen aufgetan über den Menschen dieses Tales. Er hat gesehen, wie sie pflügend, säend und erntend über unsere Hügel schritten, wie sie jagend oder kämpfend unsere Wälder durchstreiften, wie ihnen Mütter das Leben schenkten und wie sie Nachbarn zu Grabe trugen. (Wer aber die 1200 Jahre in ihrer wahren Fülle zu fassen versuchte, der müßte zählen können die Gebete, die gesprochen wurden, die Eide, die geschworen und die Lieben, die beteuert wurden, der müßte zählen die Verrate, die gesündigt und die Tränen, die geweint und die Guttaten, die getan wurden.)
Jenes frühe 8. Jahrhundert war anscheinend ein glückliches Jahrhundert unserer Heimat, und Arbeo, der Südtiroler auf dem Bischofsstuhl in Freising, preist voll Heimatstolz unser Land, und dazu gehörte Glonn: „Es besitzt Eisen in Fülle, Silber und Purpur im Überfluß.
Der Boden scheint von Viehherden überdeckt zu sein. Seine Männer sind hoch gewachsen und stark, sie sind auf Nächstenliebe und Sitte gegründet.“ Damals zeigte Regensburg mit Quadern und Türmen immer noch das Bild der alten Römerstadt, den ehemaligen Lagerplatz der 3. Legion, und es gab kein „Munichen“, noch lange nicht, und es gab noch nicht die ragenden runden Türme der Frauenkirche.
+
Aus diesem Wort rief Gott
WOLFGANG KOLLER
in die ewige Heimat.
Einst haben die Menschen aus dem Chaos der Natur Kultur geschaffen. Heute aber wächst in der Welt neues Chaos, das dem Menschentrieb und dem Menschenwerk entstammt und das eine neue Bösartigkeit in sich trägt, das schlimmere Dämonen kennt als jene Menschen sie fürchteten, die in den Wohngruben der Steinzeit bei uns wohnten; ein modernes Chaos macht sich breit, mit argen Verbrechen, mit sinnlosen Kämpfen und mit der weltweiten Möglichkeit zum Untergang.
Aber wie in Beethovens 9. Sinfonie möchte ich jetzt rufen: 0, Freunde, nicht diese Töne! Stimmt freudvollere an!
So denke ich denn gern und dankbar daran,, daß die Römer nicht nur ihre Macht, sondern auch Kultur in unser Land brachten und daß man die musische Begabung der Altbaiern, ihr Talent für Bauen und Formen, für Theater und Spiel, für Singen und Musizieren teilweise der Einmischung aus der römischen Besatzungszeit zuschreiben darf. Die Musik, auch in Glonn und im Bairer Winkel von jeher zu Hause, ist „das königliche Geschenk“ unseres Stammes an die Welt. Haydn, Schubert und Mozart waren mit Überzeugung altbaierisch-österreichische Menschen, und wie Bischöfe und Minister kamen sie aus einfachem Volk. So war Haydn der Sohn eines Hufschmieds und einer Köchin, genauso wie Lena Christ, die Glonns Namen weit ins deutsche Land getragen hat. Mit den Römern sind sicher auch (vielleicht noch heimlich) die ersten Christen zu uns gekommen.
Die eigentlichen Verkünder der Botschaft von der Menschwerdung Gottes aber waren für uns die Kelten. Mit dem ihnen eingeborenen Wandertrieb kamen sie über Frankreich ins bayerische Land. „Mit langem Haar, mit gefärbten Augenlidern und dem ledernen Quersack auf dem Rücken“ ähnelten sie ganz und gar nicht den sanften Gestalten der Schulwandbilder unserer Kinderzeit, eher schon den wilden „Blumenkindern“ dieser Tage.
Ratpot beurkundete damals, daß er seine Stiftung „auf Eingebung des höchsten göttlichen Lenkers“ mache, und so sind Ratpots Name und der Name des dreifältigen Gottes in den Grundstein der Glonner Geschichte geschrieben. Möge uns das Segen bringen bis ans Ende der Zeiten!
Noch zwei Geschehnisse aus dem Jahr 774 seien erwähnt: 774 zerschlägt Karl der Große das Reich der Langobarden. In unserer Mundart hat sich noch manches langobardische Wort erhalten. Lassen sie mich nur das Wort „dengg“, das ist links, erwähnen. Sehr klug hat das eine Wirtin angewandt, als sie beim Leichenmahl die Lobreden der Männer auf den Dahingegangenen angehört hatte. Sie sagte: „Hobts scho recht, daß ‘n so g’lobt hobts. Auf der oan Seitn war er ganz recht, auf der andern sand mia a dengg!“
Das zweite Geschehen behält sich leicht im Gedächtnis. Am 29. September 774 wird in Salzburg der erste Dom eingeweiht, und Salzburgs Bischöfe sind stolz auf die Geschichte ihrer Kirche.
Den ersten Priester können wir erst 47 Jahre später nachweisen. Er hieß Ratpote, aber er war sicher nicht identisch, was hier eingeschaltet sei, mit Ratpot, dem Stammvater Glonns von 774.
Zu Ratpots Zeiten erließ der strenge Frankenkaiser Karl der Große ein Gebot, daß Männer und Frauen das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und die Taufformel lateinisch zu lernen hätten. „Und der sie nicht festhält“, so heißt es wörtlich übersetzt, „soll Schläge bekommen, oder es sollen ihm die Getränke entzogen werden außer Wasser“, was vielleicht gerade für einen Bajuwaren die schlimmere Strafe bedeutete. Da aber das Lateinische schwer zu lernen war und selbst der Freisinger Bischof Arbeo ein baierisch verbildetes Latein schrieb, wurde bald hinzugefügt: „Wer es nicht anders lernen kann, möge es in seiner Sprache lernen.“ Hier haben wir also den Anfang einer muttersprachlichen Liturgie.
Das Heilige und das Heitere, im abendländischen Lebensgefühl tragisch auseinandergebrochen, gehören bei uns immer noch zusammen. Wir sehen es an unseren alpenländischen Weihnachtsliedern, an den bayerischen Krippenspielen, wir sehen es auch an der hellen, heiteren Landkirche Glonns. Franz Anton Kirch- grabner hat sie vollendet. Er hatte das Meisterrecht von Johann Michael Fischer erworben, von jenem Fischer, „der niemalen geruhet, indem er 32 Kirchen und 23 Klöster erbaute“, dessen irdischer Leib aber nun auch schon wieder 208 Jahre in der Münchner Bischofskirche sich ausruht.
Die Kirchen heben das Land aus seiner Dumpfheit und „die Kunst setzt Gottes Schöpfung fort“. So laßt uns auch heute dankbar des großen Meisters Joseph Götsch gedenken! Nach dem Krieg wurden seine Figuren von meinen Schulbuben aus dem verschmutzten Gefängnis des Langhausspeichers ins helle Schiff gebracht. Nur das wundervolle Kreuz hatte immer seinen Platz in der Kirche behalten. Wann hätten jemals Mütter auf das Kreuz und die Mutter der Schmerzen verzichten können? Christi Antlitz ist im Glonner Kreuz schon fast der Marter entronnen und heimlich schon dem Hellen und Heiteren zugewandt. Niemals vorher oder nachher hat Götsch diesen Ausdruck wieder erreicht. Des Künstlers eigenes Leben endet auf der Schattenseite. Er hat am Ende nichts mehr als seine nicht mehr gefragte Kunst, seine Armut und seinen siechen Körper.
Schicken wir in dieser Stunde auch einen Gruß hinüber in das neue evangelische Gotteshaus. In seiner Mitte liegt die Bibel, welche die katholische Kirchsngemeinde stiftete; ein gutes Zeichen unserer Zeit.
Zwischen den beiden Gotteshäusern steht das Schulhaus. Wir danken den Lehrern, die nicht nur um dieser Lage willen sich bemühen, daß die Glonner Schule, dem Auftrag des Volkes und der Verfassung getreu, dem Verhalten und dem Geiste nach eine christliche Schule bleibe! Eine nüchtern-verwissenschaftlichte Pädagogik und innerweltliche Heilslehren können unsere Kinder nicht glücklich und ihre Zukunft nicht sicherer machen!
1742, also noch in dem Krieg, der 30 Jahre gedauert hat, kam aus Marktl, woher heute auch unser neues Heimatbuch ankam, ein ehemaliger Richter als erster nachweisbarer Lehrer nach Glonn. In unserer Zeit und unter der mildlässigen Herrschaft von Bürgermeister Eichmeier und mit der Kraft seines energischen, zielbewußten Mitarbeiters und Nachfolgers Anton Decker wurde ein großes Schulzentrum geschaffen. Das geschah nicht bloß um eines großen Fortschritts willen, denn ein solcher kann ja auch von der Mitte des Lebens wegführen. Es geschah, damit das Gute in der Heimat immer stärker bleibe als das Ungute, und damit das Aufbauende über das Hinunterziehende und Zerstörerische obsiege.
Nahe der neuen Schule liegt das Kugelfeld von 1632, auf dem schwedische Soldaten „vil der bauren wacht“ umgebracht haben. Männer aus den Pfarreien des Leitzachtales und dem Land um den Wendelstein sind in Glonn zusammengehauen worden: Bauern, Maurer, Weber, Schuster. „Hanns Springer hat einen Bettelbuben geschickt, ist auch geblieben.“ — Geblieben ist auch ein Dientzenhofer, zu dessen Nachfahren jene fünf Baumeister-Brüder gehören, welche die Kraft deutschen Bauens von Fulda über Bamberg und Banz bis nach Prag getragen haben.
Glücklicher als die Bauern von 1632 kämpften für die Heimat jene Männer des Freikorps Grafing-Glonn, die 1919 mitgeholfen haben, daß der Münchner Marienplatz nicht ein Platz Lenins geworden ist. Gefahr aus dem Osten bedrohte das Abendland auch in der Zeit der Türkenkriege. 1682 belagerten Türken zum zweiten Male Wien. Aber „der blaue König“ aus München, Kurfürst Max Emmanuel, brach mit seinen Arco-Kürassieren als erster ins Türkenlager ein und die Soldaten sangen: „Da Kurfürst aus Boarn / is a rechtschaffner Mo, / is lang nit dreißig Jahr, / hot vui dabei to“. — Als die Nachricht vom Sieg nach Glonn kam, wurden alte Leute vor Freude wieder gesund, und der Pfarrer Wolfgang Gebhard schreibt in gutem Latein Hexameter ins Taufbuch. Er dankte Gott, „der alles Gute den Unsern, dem Feinde aber nur Kriege gebracht hat“. — Heute noch heißt man einen ungebärdigen Buben in unserer Gegend einen „Türkl“, und wenn es nottut, schreibt ihm der Vater auch einen Hexameter auf das Gesäß, und so es ein richtiger Glonner ist, hält er es aus.
In den beiden Weltkriegen kamen 198 Söhne der Gemeinde nicht mehr zu uns zurück. Und 1954 sagte Professor Lebsche: „Wer hätte schon in unserer Talschaft den Krieg gewünscht? Aber denen, die ihre Heimatliebe unter Beweis gestellt haben, versprechen wir, daß wir sie nicht schmähen lassen.“
Gesundes Mißtrauen der Glonner gegen laute Töne hat es den Glonnern 1933 —1945 verwehrt, es mit den Posaunenbläsern zu halten.
Sie sagten, „Jetzt scho! Aber hernach!“ Auf die Nachricht vom Einzug deutscher Turppen in Paris sagte ein Bauer zum Verkünder der Siegesbotschaft: „Des ko scho sei, aber i muaß jetzt arbatn, daß mia an Troad kriagn, fois in Paris grod koana wachsat!“ Und ein Knecht, der beim deutschen Gruß mit erhobenem Maßkrug statt „Heil Hitler!“ „Dreimal drei Liter!“ gerufen hatte, bemerkte vor dem Amtsgericht Ebersberg: „Des ko koa Mensch vo mir ver- langa, daß i ois Knecht d’Hand laar aufheb.“
1937 ließ Gauleiter Wagner die klösterlichen Lehrerinnen abbauen, doch verschenkte er damit auf Grund einer Stiftungsklausel das Mädchenschulhaus an das Münchner Domkapitel; da sage noch einer, der Gauleiter Wagner hätte einen antiklerikalen Affekt gehabt! – Eure Eminenz, so getreu wir zu Ihnen stehen, so fromm wären wir Glonner doch nie gewesen, das Schulhaus, das einst das schönste und gepflegteste des ganzen Bezirksamtes war, Ihren Herren zu schenken!
1973 haben wir gar noch übersehen, wenigstens das kostbare Bild des Heiligen Geistes aus der Mädchenschulkapelle für Glonn zu retten! Gewiß brauchen die Herren vom Domkapitel in dieser schwierigen Zeit Heiligen Geist, aber ob ihn wir Glonner die nächsten 1200 Jahre nicht auch noch brauchen werden? In den Gemeinden Glonn, Baiern und Höhenrain war die Gesinnung der Freihet in den „Tausend Jahren“ hochgehalten worden, und es ist eine Ehre für uns, daß man uns damals in politischen Versammlungen Glonnkosaken nannte. Und der große Humanist, der des wirksamen und mutigen Wortes mächtige Pfarrer Boxhorn, war damals der richtige Pfarrer für uns. Er ließ sich nämlich nie ins Boxhorn jagen, und er ahnte viel Zukunft, als er in die Friedensglocke von 1949 den Spruch gießen ließ: „Zögere nicht, Königin des Friedens, dich zu erbarmen der aus den Fugen geratenden Welt.“
Daß sich nach 1933 der Zwang und die Überwachung gegenüber den freiheitlich Gesinnten bei uns in Grenzen hielt, ist freilich ebenso anzuerkennen wie die Tatsache, daß nach 1945 die religiöse Gesinnung und das nachbarschaftliche Gefühl die Gedanken der Vergeltung nicht ins Kraut schießen ließen.
Der den Altbaiern und damit den Glonnern heilige Begriff der Nachbarschaft bekam eine neue Dimension, als viele Hunderte Heimatvertriebene an unsere Türen klopften. Aus dem Nebeneinander – leben – müssen wurde immer mehr ein Miteinander-leben-dürfen. Die arbeitsamen, biederen Nachfahren der deutschen Donauschwaben, die ernstgestimmten Schlesier und die so werktüchtigen Sudetendeutschen mit den uns so stammesverwandten, lebensfrohen Egerländern, brachten Herz und Fähigkeiten für einen neuen Anfang mit.
Eine nun heraufblühende Schönwetterperiode wurde für Werke des Friedens genützt. Das Glonner Straßenkreuz setzte Strahlenflügel an. Das Altersheim entstand, und die jungen hübschen Schwestern aus Kroatien beweisen, daß der Baum der Kirche immer noch zu blühen vermag — und wäre es über hartem Grund. Straßen wurden gebaut, und andere bemühten sich, daß die inneren Wege von Mensch zu Mensch begehbar blieben. Denn ohne solche Wege wäre das Leben nicht mehr lebenswert, und die schönste Landschaft gäbe keine Heimat mehr. — So danken wir auch allen, die sich darum bemühen und weiter darum bemühen werden, daß bei uns parteiliche Gegensätze gute Nachbarschaft nicht überschatten.
Jedem ist auf dieser Erde seine Rolle zugewiesen ! Es kommt nicht darauf an, wie groß, wie schlicht sie ist. Wichtig ist allein, wie gut wir unsere Rolle spielen. „Als ik kann“, schrieb der Maler van Eyck auf eines seiner Bilder. Und ein römischer Dichter meinte: „Erst am Zahltag kannst du sehen, daß Augustus etwa zehn, doch der Hirte auf dem Feld 40 Kronen für sein besseres Spiel erhält.“
Das hindert uns nicht, als Glonner ein wenig stolz zu sein auf Frauen und Männer, die dem Namen der Heimat auf ihre Weise über die Heimat hinaus Glanz und Farbe gegeben haben.
Da ist Lena Christ, das ledige und unerwünschte Kind einer 21-jährigen Glonnerin. Lena Christ hat viel Dunkel durchlitten. Schuld und Schicksal konnte sie nicht immer unterscheiden, aber mit ihren besten Büchern hat sie eine klassisch-bayerische Trilogie geschrieben und damit der Heimat einen unsterblichen Dienst getan. Es ist nicht so, daß nur unerwünschte Kinder eine Heimat schöner und die Welt reicher machen können!
Und ich denke an Maria Leopoldine, Erzherzogin von Österreich, letzte bayerische Kurfürstin, spätere Schloßherrin auf Zinneberg, verehelichte Gräfin Arco, Enkelin Maria Theresias und Nichte der unglücklichen französischen Königin Maria Antoinette. Sie war es, die Bayern 1795 vor dem Zugriff Österreichs gerettet hat. Sie war es auch, die dem Schloß Zinneberg seine klassizistische Fassade gestalten ließ und die herrliche Anlage der Gärten schenkte — heute das Heim der „Guten Hirtinnen“ für ihren erzieherisch sehr liebenswürdigen Dienst an jungen Mädchen.
Zuerst Professor Max Lebsche, den großen Menschen, Christen und Arzt, den Wohltäter und Sprecher der Heimat. Einmal sagte er: „Jeder von uns kann sicher noch mehr lächeln, noch mehr schenken, noch mehr verzichten, noch mehr verzeihen und noch mehr danken.“ Er war im Dritten Reich der konsequenteste Anwalt für Freiheit und Recht.
Ich nenne meinen Bruder, der als einzige Schule die in Glonn besucht hatte und der letzte Generalstabschef der Luftwaffe war, der mit der präzisen Nüchternheit seines Tagebuches aus dem letzten Monat des Krieges Legenden zerstörte, im Krieg die großartigen französischen Kathedralen vor allen Angriffen schützte, und der auf Bitten von Professor Lebsche Ravenna aus der Kampflinie nahm, damit in den ältesten Kirchen des Abendlandes auch den künftigen Zeiten jugendfrisch Christus als der gute Hirte aus den Mosaiken des 4. Jahrhunderts leuchten kann.
Ich nenne auch noch den Lederersohn Corbi- nian Sarreiter, der das Kloster Beyharting wieder aufbaute, und ich nenne Pfarrer Niedermair, den Heckmair-Sohn, den treuen Chronisten von Glonn.
Ich komme zum Schluß:
Vieles hat sich seit 20 Jahren wieder zum Unguten verändert. Vieles hat sich ins Gefahrvolle hinbewegt. 30 Jahre genügten, um ein Gebirge von Irrtum und ein Meer von Blut und Tränen schon wieder zu vergessen. So fragen wir uns alle: Was wird aus unseren Kindern und Kindeskindern werden, was aus unserer Heimat, was aus dem christlichen Abendland, was aus unserer Freiheit? Wenn das Abendland wieder leuchten soll, dann muß es viele wahre Heimatländer in sich bergen. Geben wir das unsere dazu!
Als Glonner gehören wir zu einem Stamm, den Gott seit eineinhalb Jahrtausenden in dem Land vor den Bergen beließ. Als Glonner sind wir darum konservativ, aber wir sind es mit dem Gesicht nach vorn. Wir brauchen für unser Vaterland die verschiedenen Heimaten, aber nicht modeunterworfene Allerweltszivilisation.
Weil wir glauben, glauben wir nicht alles! — Weil wir lieben, was wert ist geliebt zu werden, lieben wir es nicht, wenn andere versuchen, uns in unserem Denken umzufunktionieren.
Auch die Heimat löst nicht die Rätsel dieser Erde, aber sie hellt uns manche auf, und sie läßt uns die anderen leichter ertragen.
Ein Jahrtausend geht zu Ende. Freuden verklingen, Leiden verrinnen, Häuser vergehen, Bäume vergehen, Menschen versinken, Freunde und Nichtfreunde, Kriege vergehen, Ruhm verweht. Aber über allem, was vergangen und vergeht, leuchtet das Unzerstörbare. Leisten wir diesem unseren bescheidenen Dienst in der schwindenden Zeit!
Gegen den Terror des Aktuellen setzen wir den Wert des Bleibenden, gegen die Oberflächlichkeit das Innerliche, gegen die Hektik der Tage das In-sich-Ruhende, gegen die müde Trauer der auseinandergehenden Glieder die Freude der menschlichen Nachbarschaft, gegen den Wirbeltanz der Hin- und Hergerissenen, die Treue zu den Freunden, gegen die Verfremdung die Heimat.
So möge denn die Heimat immer wieder Frauen haben, die Brücken nicht einreißen, sondern bauen, die zu lieben wissen, wenn Männer in törichte Streite geraten!
So möge denn Glonn, wie seit 1200 Jahren, immer wieder auch Männer haben, die streng sind gegen sich selbst, die gütig sind zu anderen, dankbar den anderen!
Möge Glonn immer wieder Freude an Kindern haben und sie liebevoll-streng umschützen, und möge sich in diesen Kindern das Unbekannte, das auf sie zukommt, mit dem verbinden, was uns heilig ist!
Gott segne dieses Tal; Gott segne unser liebes, schönes Land und das ganze bedrohte Abendland; Gott segne alle, die für unsere Heimat, die für unser Land Liebe und Sorge tragen!
Kardinal Döpfner unmittelbar nach dem Tod Wolfgang Kollers:
Soeben hat der Herr über Leben und Tod unseren lieben Schulrat Koller, der so viel getan hat für dieses Fest und eben mit einer so innigen, tiefen Heimatliebe und Begeisterung gesprochen hat, zu sich gerufen. Es ist ein besonderer Anruf in diese Stunde hinein. Es ist für uns überraschend; nehmen wir es so an, wie der Herrgott es uns zuspricht, und wir zeigen unsere Verbundenheit und Dankbarkeit für den Toten, der so viel für Ihre Heimat getan hat, indem wir nun seiner im Gebet gedenken und all denen, die ihm verbunden sind, die Kraft des Herrn in dieser schweren Stunde erbitten . . .
Die Angaben über das Leben Wolfgang Kollers und die Übertragung seiner Festrede aus dem Stenogramm besorgten Herta Rotter, Franz-Josef Gaßner und Lászlò Schwarzenberger. Foto: Helmut Wohner
Digitalisiert von Stephan Kreutzer